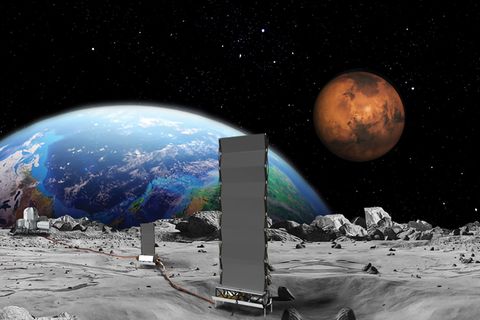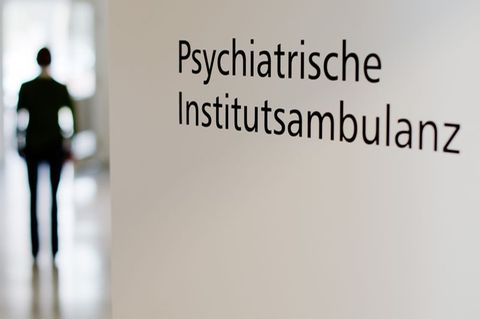Deutschland um 1900: Aufbruchszeit, nüchtern offenbar kaum zu ertragen. Bier ist begehrt wie nie. Der durchschnittliche Konsum liegt bei 245 Litern pro Kopf und Jahr, zweieinhalbmal so viel wie heute. Erheben die Brauer darum so großspurige Forderungen? Sind die Brauereibesitzer berauscht vom Erfolg, von zu viel Bier oder beidem – und darum so großzügig? So ganz genau lässt sich das alles nicht mehr rekonstruieren. Fakt aber ist: 1903 erstreiten Brauer als erster deutscher Branchenverband den Urlaubsanspruch, drei Tage finanzierte Freizeit. Nicht viel, verglichen mit heute. Und dennoch der Anfang des gesetzlichen Faulenzens.
Miruna Xenocrat, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Arbeitnehmerhilfe München, gibt einen Überblick zum Urlaubsanspruch
Wer legt den Urlaub fest?
Komplizierte Kiste: Laut § 7 des BUrlG legen zwar Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den Zeitpunkt des Urlaubs fest. Sie müssen dabei aber den Wünschen ihrer Arbeitnehmenden folgen – es sei denn, betriebliche Zwänge oder die Urlaubswünsche anderer sprechen dagegen. Vorrang hat stets die- oder derjenige, für die/den es um den ersten Urlaub im jeweiligen Jahr geht. Auch Eltern, die auf Ferienzeiten angewiesen sind, bisweilen. Sie haben jedoch kein verbrieftes Recht darauf.
Kann zusammenhängender Urlaub verwehrt werden?
Grundsätzlich verlangt das BUrlG vom Arbeitgeber, den Urlaub zusammenhängend zu gewähren. Ist das aus betrieblichen Gründen unmöglich, sollten es zwei Wochen am Stück mindestens sein. Sonst setze kein Erholungseffekt ein, so das Gesetz. Auf gar keinen Fall können Arbeitnehmende gezwungen werden, den gesamten Urlaub in Einzeltage zu zerlegen.
Kann Urlaub verfallen?
Im Grunde: nein. Wird ein Arbeitnehmer nicht von seiner Chefin darauf hingewiesen, dass er seinen Urlaub bis zu einem Stichtag X nehmen soll, verfällt ein Urlaub gar nicht mehr – so der jüngste Entscheid des Europäischen Gerichtshofes. Ob Urlaub verjähren kann, wird derweil noch höchstrichterlich entschieden. Anders ist es, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihrer sogenannten "Mitwirkungspflicht" nachkommen – und ihre Angestellten rechtzeitig und wiederholt darauf hinweisen, ihren Urlaub bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu nehmen. Tun diese das dann nicht, verfällt der Urlaub.
Muss man im Urlaub erreichbar sein?
Nein! Niemand muss erreichbar sein, selbst wenn er ein Diensthandy besitzt. § 1 des BUrlG sichert jeder und jedem Beschäftigten Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub zu. Und Erholung ist nur dann gewährleistet, wenn der oder die Beschäftigte nicht ständig mit Anrufen oder E-Mails rechnen muss. Sonderklauseln in Arbeitsverträgen, die die permanente Erreichbarkeit zur Pflicht machen, sind unzulässig, hat das Bundesarbeitsgericht entscheiden. Dies gilt jedenfalls für die vier Wochen Urlaub, die Angestellten per Gesetz zustehen. Für alle freiwillig gewährten Urlaubstage kann es Sonderregeln geben.
Kürzt Kurzarbeit den Urlaubsanspruch?
Ja. Wird durch die Anordnung von Kurzarbeit die Arbeitspflicht aufgehoben, dürfen Arbeitgeber den Urlaubsanspruch herunterrechnen – um ein Zwölftel für jeden vollen Monat. Stehen einer oder einem Angestellten 24 Urlaubstage zu, vermindert sich der Anspruch monatlich um je zwei Tage – wie Gerichte während der Corona-Pandemie bestätigten.
Was passiert mit dem Urlaubsanspruch, wenn jemand von Voll- in Teilzeit wechselt?
Ein einmal erworbener Urlaubsanspruch darf nicht gemindert werden – auch nicht, wenn man seine Stundenzahl reduziert. Beispiel: Eine in Vollzeit angestellte Frau kann ihren Urlaub wegen Schwangerschaft und Beschäftigungsverbot nicht nehmen. Steigt sie nach der Elternzeit in Teilzeit ein, bleibt der bis dahin in Vollzeit erworbene Urlaubsanspruch in vollem Umfang bestehen.
Denn die Unerschrockenheit der Brauer steckt Mitarbeitende anderer Branchen an. Bald fordern auch Gemeinde- und Staatsbedienstete, Buchdruckerinnen, Transport- und Fabrikarbeiter bezahlte Auszeiten. Erfolgreich. Allerdings: Bis wirklich jeder und jedem Angestellten ein einklagbares Recht auf Urlaub zusteht, dauert es noch bis zur Verabschiedung des Bundesurlaubsgesetzes im Januar 1963.
Mehr davon!
Seither erst ist Urlaub für uns nicht nur üblich, sondern auch immer üppiger geworden. Rund 28 Tage jährlich stehen jedem, jeder Deutschen – im Schnitt – mittlerweile zur Verfügung; bis zu elf Feiertage hinzugezählt, können hiesige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer damit bei vollem Lohn etwa acht Wochen frei nehmen. In nur wenigen Ländern der Welt ist der Anspruch höher. Vielen Menschen hierzulande aber, so eine repräsentative Umfrage, ist das noch immer nicht genug. Vier, fünf Tage obendrauf wären ihnen schon recht.
So selbstverständlich ist der Urlaubsanspruch für uns geworden, dass leicht in Vergessenheit gerät, welch junge und famose Errungenschaft das eigentlich ist. Denn Urlaub bedeutet ja grundsätzlich, Geld für Nichtstun zu bekommen. Das ist – um zu den Brauern zurückzukehren – fast so unerhört, als saufe jemand und der Wirt hätte am nächsten Tag die Kopfschmerzen.
Wenig verwunderlich darum, dass Unternehmer und Chefs lange nichts von Urlaub wissen wollen. Zwar empfiehlt schon das Alte Testament, am siebten Tage zu ruhen. Doch den Industriellen des 17. und 18. Jahrhundert ist das Bilanzbuch die Bibel – und der Profit alles. So lassen sie ihre Arbeiter immer mehr und immer länger schuften, bis zu 16 Stunden täglich, auch sonntags. Urlaub: allenfalls ein "Gnadenakt" (wie auch die wörtliche Übersetzung des altdeutschen Wortes lautet), den Fürsten oder Fabrikanten Einzelnen auf Anfrage gewähren.
Auch als sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts erste Arbeiter in Gewerkschaften organisieren, ruft lange niemand nach Urlaub. Die Männer und die wenigen Frauen wollen mehr Geld für ihr Schaffen, aber doch kein bezahltes Nichtstun. Unwirklich, ja, utopisch kommt den meisten solch eine Forderung vor. Selbst nachdem Brauer, Buchbinder und die Betriebsräte einzelner Unternehmen einen Urlaubsanspruch erkämpft haben, bleiben viele misstrauisch. Als ein Vorarbeiter des Berliner Elektrogeräte-Herstellers AEG 1916 zum ersten Mal nach 20-jähriger Tätigkeit vier Tage Urlaub erhält, stratzt er jeden Mittag zum Betrieb und prüft, ob unterdessen nicht doch jemand anderes seinen Arbeitsplatz übernommen habe.
Die Weltkriege bremsen die Entwicklung, aber löschen sie nicht aus. Die DDR schreibt schon 1951 in ihrer Verfassung das Recht auf Urlaub fest. 1963 dann, nach zähem Ringen der Gewerkschaften, sichert das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) auch allen westdeutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bezahlte Freizeit zu: drei Wochen, am besten zusammenhängend gewährt und genommen. Denn ein Mensch braucht Erholung, das ist die Kernaussage dieses bis heute in seinen Grundzügen unveränderten Gesetzes. Etliche Artikel sichern entsprechend, dass Chefs nur schwer in die Urlaubszeit hineinregieren können.
Ab in den Süden
Was folgt, ist ein massenhafter Aus- und Aufbruch gen Süden. Irgendwie muss die freie Zeit ja gefüllt werden! Mit den Jahren werden die Deutschen immer anspruchsvoller, gar nicht mal, was Urlaubsort und -unterkunft anbelangt, sondern: den Urlaubsanspruch. In den 1970ern ringen die Gewerkschaften Arbeitgebern knapp sechs Wochen bezahlte Freizeit ab – bis heute Standard in den allermeisten tarifgebundenen Branchen und Betrieben. Der Staat ist da übrigens längst nicht so spendabel. Das gesetzlich vorgeschriebene Urlaubskontingent liegt heute bei vier Wochen.
Die Arbeitgeber haben all dies in den vergangenen Jahrzehnten erstaunlich gelassen hingenommen. Denn am Ende geht die Rechnung auch für sie auf: Gut erholte Mitarbeitende fehlen nach ihrer Urlaubsrückkehr seltener durch Krankheit, sind tatendurstiger und effektiver. Untersuchungen zeigen, dass regelmäßige Auszeiten vom Job beste Burnout-Prävention sind, Blutdruck und Stress‑level senken. Ein Eintauchen in andere Kulturen und Umgebungen fördert zudem die Kreativität.
Zwölf Städte in Europa, deren Highlights sich gut zu Fuß erkunden lassen

Zwölf Städte in Europa, deren Highlights sich gut zu Fuß erkunden lassen
- Reine Gehzeit: 61 Minuten
- Länge der Route: 4,7 Kilometer
- Anzahl der Schritte: 6090
Manche Bosse bieten ihren Angestellten darum mittlerweile unbegrenzt viele Urlaubstage an, bei vollem Gehalt natürlich. Die Idee stammt aus den USA, wo – anders als hierzulande – bis heute kein Gesetz einen Arbeitgeber zwingt, bezahlte Freizeit zu gewähren. Mit "Urlaub unlimited" versuchen sie, begehrte Mitarbeitende zu ködern und an sich zu binden.
Ferien unlimited
Mittlerweile haben auch deutsche Firmen das Konzept übernommen. Allein auf den großen Jobportalen im Netz lockten in den vergangenen Jahren weit über 100 Arbeitgeber mit "Ferien, so viel man will". Ein Traum. Vermeintlich.
Denn die jüngste Erfahrung lehrt: Wer so viel Urlaub nehmen darf, wie er möchte, nimmt – ziemlich wenig. Manche US-Angestellte verzichteten durch die neuen Urlaubsvereinbarungen gar völlig auf freie Tage. Eine deutsche Firma analysierte, dass ihre Angestellten deutlich weniger Urlaub machten, als ihnen gesetzlich zustünde.
Warum nur? Tatsächlich offenbart eine Studie unter 1500 Niederländerinnen und Niederländern: Urlaube bescheren Glücksgefühle am verlässlichsten, noch ehe wir sie antreten. Oder anders gesagt, ehe unsere Urlaubsfantasien von der Realität eingetrübt werden – von der schlauchenden Anreise, der mittelmäßigen Unterkunft, den quengelnden Kindern.
Wahrscheinlicher aber ist, dass die vollkommene Ferien-Freiheit Angestellte verunsichert. Haben sie keine klaren Vorgaben, scheuen sie, viel Urlaub zu nehmen, um nicht als Faulpelze abgestempelt und aussortiert zu werden. In den USA, aber auch in Deutschland haben darum einige Firmen, die vor Jahren das Urlaubslimit aufgehoben haben, nun eine Zusatzregel eingeführt: Jeder nimmt so viel er will, aber mindestens vier Wochen – exakt das also, was das Bundesurlaubsgesetz bereits seit 1963 vorschreibt …
Übrigens: Auch viele Urlaubspioniere – darunter die Brauer – scheuen anfangs, ihre hart erkämpften Urlaubstage zu nehmen. Lieber wollen sie fleißig sein, durcharbeiten und den Urlaub "abgelten", also bezahlen lassen. Diese Praxis ist allerdings bald verboten. Bis heute.