Verena Brüning, eine junge Frau mit Pferdeschwanz und blondem Pony, lacht nach oben in die Kamera. Den Arm hat sie um die Wanten geschlungen, eine borstige Strickleiter, die hochführt auf den Großmast der Brigg "Roald Amundsen". Unter ihr: 30 Meter Nichts. Dann das hölzerne Schiffsdeck und tiefblaues, rauschendes Meer. Das Bild zeigt die Fotografin Anfang des Jahres, als sie eine einzigartige Fahrt begleitet hat: In 24 Tagen quer über den Atlantik, auf einem Segelschiff mit viel körperlicher Arbeit und wenig Schlaf – und an Bord nur Frauen. Ihren Fotoband zur Fahrt kann man bald kaufen. Dies ist ihre Geschichte.
Ab Tag eins funktionierten die Handys nicht mehr. Selbst wenn jemandem ein Familienmitglied gestorben wäre, hätten wir es nicht erfahren. Und hätten ohnehin nicht von Bord gehen können. Auf den 3167 Seemeilen, die wir zwischen Teneriffa und Martinique zurückgelegt haben, gibt es kein Land.
Als Kind habe ich immer Abenteuerromane gelesen, die auf dem Wasser spielen. Geschichten über Störtebeker, Moby Dick, Jack Londons Schatzinsel.
Manche Leute finden das furchtbar langweilig – all die Details darüber, was auf einem Boot so passiert. Aber ich habe die Beschreibungen des Lebens an Bord und die speziellen Schiffsausdrücke immer aufgesaugt. Und jetzt war ich plötzlich in dieser Welt, die mir nur aus Büchern und Filmen bekannt war. Ich war begeistert.
Vor der Abfahrt absolvierten wir im Hafen einen Tag lang Kletterübungen – solange das Schiff noch einigermaßen ruhig lag. Die höchste Rah ist 36 Meter hoch, und nicht alle von uns waren erfahrene Seglerinnen. Zur Hälfte bestand die Crew aus Leuten des Vereins "LebenLernen auf Segelschiffen e.V.", dem die "Roald Amundsen" gehört. Alle anderen waren Trainees – sie hatten mehr für die Reise gezahlt und wurden unterwegs ausgebildet, daher der Vereinsname. Wir waren eine sehr gemischte Truppe, zwischen 19 und 67, Tierärztinnen, Schauspielerinnen, Studentinnen.
Brünings Fotos zeugen davon, wie eng es sich auf einem Traditionssegelschiff lebt – kein Vergleich mit Luxusyachten oder gar Kreuzfahrtschiffen. In die Kammern zwängen sich vier, sechs oder acht Kojen: Schrankbetten, zu denen jeweils nur ein kleines Regal gehört, oft nicht größer als ein Bücherfach. Koffer darf niemand mitbringen, weil die sich gar nicht verstauen ließen. Manches bringen die Frauen einfach auf den Betten unter, schlafen auf Büchern und Pullovern. Weil das Schiff mit 47 Personen belegt ist, haben sie kurzerhand noch Hängematten gespannt. Dazwischen baumeln Socken und T-Shirts; in manchen Hängematten schaukeln Kohlköpfe und Bananen, damit sie besser vor Druckstellen geschützt sind.
Wir haben uns in ein klassisches Wachsystem aufgeteilt: Alle acht Stunden hatte jede Dienst, immer für vier Stunden, von zwölf bis vier, vier bis acht oder acht bis zwölf, jeweils zur Tages- und zur Nachtzeit. In unserer Kammer war jede Wache vertreten. Das hieß: Immer schliefen einige, und immer stand gerade jemand auf und kramte herum. Vier bis acht war meine Lieblingswache, dann sah man die Sonne entweder auf- oder untergehen.

Die Wachen der Nacht backten Brötchen für den Morgen, drehten Sicherheitsrunden und unterhielten die Rudergängerin, die den Kurs hielt. Die Brücke hat kein Dach, dort ist man jedem Wetter ausgesetzt. Wir brachten uns mit heißem Tee und Süßigkeiten über die Zeit.
Tagsüber lernten wir dazu noch Knoten oder die Namen und Position der Leinen. Ansonsten wurde vor allem geputzt: Klos und Duschen, Deck und Treppen, Flure und Niedergänge wurden jeden Tag gewischt. Denn Salzwasser überzieht alles mit einer rutschigen Schicht.
Manöver wie Wenden oder Halsen sind wir selten gefahren, im Prinzip segelten wir die ganze Zeit in eine Richtung, kleine Anpassungen reichten aus, etwa indem wir die Rahsegel besser in den Wind gestellt haben. Manchmal mussten wir auch schlechtem Wetter ausweichen. Abhängig vom Wind wurden die obersten Segel der beiden Masten, die Royalsegel, meistens zum Abend hin eingeholt und morgens wieder gesetzt. Einmal kam unerwartet eine stärkere Brise auf. Also bin ich mit einer weiteren Frau aus der Crew hochgeklettert. Der Vollmond schien, trotzdem war es ziemlich dunkel. Hinauf ging es gut, aber beim Abstieg über die Wanten, eine Art Strickleiter, habe ich kaum mehr gesehen, wo ich hintrete. An Deck sind mir die Beine richtig weggesackt, so ein Adrenalinschub war das.
Gerade zu Beginn waren auch viele von uns seekrank. Die Erfahrenen wussten schon: Ich bin drei Tage krank, und dann geht es wieder. Aber andere haben bis zum Ende furchtbar gelitten, es tat mir leid, das mitanzusehen. Und auf diese Personen wurde besonders geachtet, wenn sie sich etwa übergeben mussten – nicht, dass noch jemand aus lauter Verzweiflung über Bord geht!
Theoretisch gibt es ein "Mensch über Bord"-Manöver, um Leute aus dem Wasser zu holen, und wir haben das auch geübt. Doch die Chance ist gering, einen Menschen wiederzufinden, besonders bei Seegang oder in der Nacht. Ein so großes Segelschiff ist nicht leicht zu manövrieren, und der Mensch verschwindet einfach zwischen den Wellenhügeln. Wir waren uns sehr bewusst, dass so eine Fahrt auch gefährlich ist.
47 Windsbräute allein auf dem Atlantik

47 Windsbräute allein auf dem Atlantik
Je weiter das Schiff der Karibik entgegen rollt, desto milder werden die Nächte. Viele übernachten jetzt in Hängematten auf Deck. Allerdings brennt dafür die Mittagssonne auf die Frauen, die mit dicken Nadeln Segeltuch flicken, die Besen wirbeln oder schnell einen Teller Eintopf hineinlöffeln, die Beine im Schneidersitz verschränkt. Wenige finden Zeit, mal ein Buch aufzuschlagen. Alltag stellt sich ein, nur unterbrochen vom Wechsel der Wachdienste und Essenszeiten. Was gleich bleibt und sich doch ständig verändert: das Meer.
Ich war oft von den Eindrücken überwältigt. Auf dem Schiff ist alles wie vor hundert Jahren. Wenn man aufs Meer schaut und sich das vorstellt, ist es, als wäre man in ein Zeitloch gefallen. Auf See geht es eigentlich nur um Licht und Farben, das ist das Einzige, was man während der ganzen Reise vor Augen hat. Aber Wasser und Himmel sehen nie gleich aus. Ohne Kitsch denkt man bei jedem Sonnenaufgang wieder: Wow! Aus den schwimmenden Teppichen von Sargassokraut leuchteten uns nachts ganze Brocken von fluoreszierendem Plankton entgegen. Eines Morgens waren wir alle ziemlich erschöpft und geknickt, als ein Minkwal auftauchte und das Schiff dann über Stunden begleitet hat.
Auf Brünings Fotos sieht man die Frauen nicht nur beim Segelsetzen und Deckschrubben. Sie hängen auch im Netz des Klüverbaums, einem Rundholz, das über den Bug des Schiffs hinausragt, und blicken auf einen unsichtbaren Punkt in der Ferne. Manchmal liegen sie sich in den Armen, lachen sich an oder haben Tränen in den Augen. Auf einem Foto, es ist Silvester, lehnen sie an der Reling, scherzen, warten darauf, schwimmen zu gehen. Die meisten sind nackt, aber niemand scheint das zu beachten. In einer gemischten Segelcrew würden solche Szenen wohl niemals passieren.

Es gab immer wieder Momente, die einfach so Spaß gemacht haben. Alle schrubben das Deck, und plötzlich wird ein Tänzchen hingelegt. Es gab ein besonderes Miteinander und viel Raum, sich auszuprobieren und über sich hinauszuwachsen.
In gemischten Gruppen ist das ein Riesenthema: Einerseits melden sich immer dieselben Männer, die Frauen halten sich eher zurück. Andererseits hat man als Frau oft erst recht das Gefühl, sich beweisen zu müssen. Man muss zeigen, dass man genauso gut ist – gleichzeitig wird einem abgesprochen, dass man es kann. An Bord gibt es immer Situationen, in denen es heißt: Das ist zu schwer, da muss jetzt mal ein starker Mann ran. Aber man kann stattdessen auch zwei mittelstarke Frauen nehmen, dann funktioniert es auch.
Die Hierarchie an Bord war allerdings sehr klar – das muss auch sein, sonst wird es gefährlich. Ich hatte früher auch Seemänner alter Schule erlebt. Einer schrie einfach alle an, wenn etwas nicht funktionierte. Der brachte jeden irgendwann zum Weinen, auch die Männer. Unsere Kapitänin hat ihren Job dagegen wunderbar gemacht. Sie hat oft mit uns im Nachgang gesprochen: Was hat gut geklappt, was nicht. Trug sie dabei ihre Mütze, wussten wir: Jetzt wird es ernst. Einmal hat sie zwei übereinander getragen, aber schreien musste sie nie.
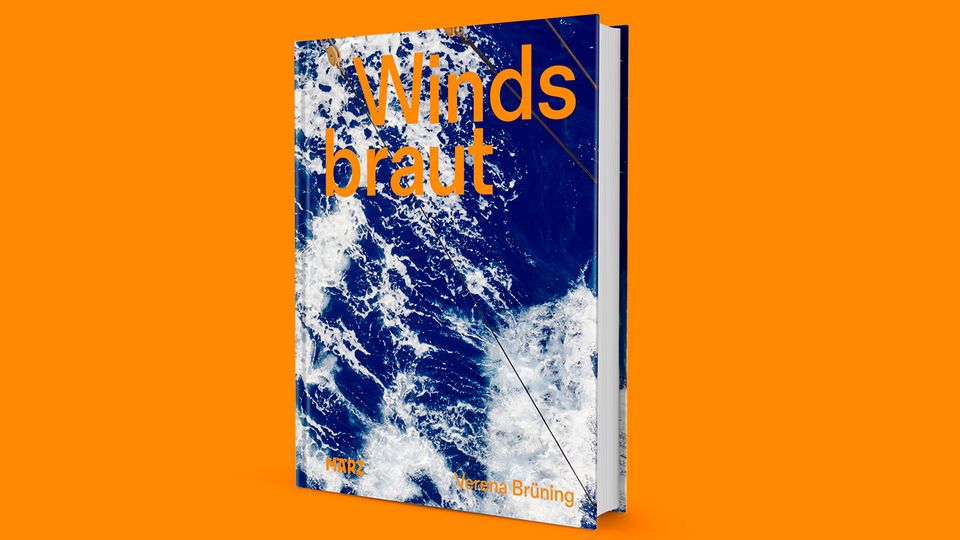
Natürlich gab es auch Konflikte, meistens um Essen. Die Kapitänin hatte vorher damit gerechnet, dass nach der Hälfte der Zeit alle ihre Schlafplätze tauschen wollen."In der Mitte der Fahrt knallt es immer", sagte sie. Das ist bei uns nicht passiert. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass nur Frauen an Bord waren. Auf jeden Fall aber hat uns die Reise zusammengeschweißt. Wie sehr, konnte ich erst nach ihrem Ende richtig verstehen. Obwohl es nicht mal ein Jahr her ist, hat sich die Gruppe schon mehrmals getroffen. Einige haben für die Zeit der Leipziger Buchmesse Hotelzimmer reserviert, wo ich wahrscheinlich meinen Bildband präsentieren werde, dabei ist das noch gar nicht sicher. So viel Zusammenhalt, das ist nicht gewöhnlich. Das ist etwas total Besonderes.



























