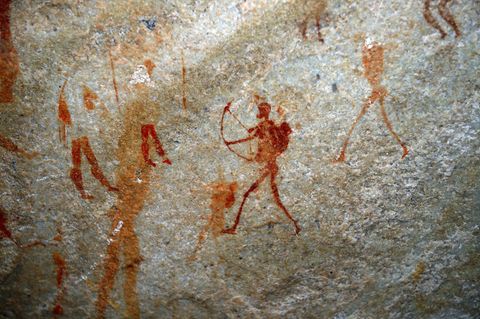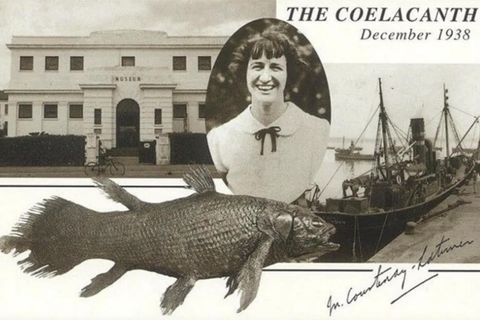Sie sah aus wie ein überdimensionierter Regenwurm, fraß aber keine Pflanzenreste, sondern konnte mit ihrem kräftigen Kiefer wahrscheinlich Schneckenhäuser aufbrechen: Eine besonders große Doppelschleiche kroch vor mehr als 56 Millionen Jahren durch Nordafrika. Ein internationales Forschungsteam beschreibt die neue Art im Fachjournal "Zoological Journal of the Linnean Society".
"Unsere Entdeckung aus Tunesien ist mit einer geschätzten Schädellänge von über fünf Zentimetern die größte bekannte Doppelschleichen-Art", erklärt Erstautor Georgios Georgalis von der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Weder gebe es heute lebende noch bekannte ausgestorbene Doppelschleichen mit größeren Köpfen.
Insgesamt könnte die beinlose Echse etwa einen Meter lang gewesen sein, fügte Mit-Autor Krister Smith Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt. Zumindest stimme das, wenn das ausgestorbene Tier etwa durchschnittliche Proportionen besaß - was man nicht genau weiß. "Alles ein wenig schwammig, aber damit muss man leben, wenn man nur Bruchteile vom Tier hat", meint der Wissenschaftler vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt.

Vorwärts und rückwärts kriechen
Doppelschleichen (Amphisbaenia) heißen so, weil bei ihnen auf den ersten Blick nicht klar ist, wo vorne und wo hinten ist. Die Schuppenkriechtiere mit dem rundlichen, stumpfen Schwanzende können sich tatsächlich sowohl vorwärts als auch rückwärts bewegen. Dabei winden sie sich nicht seitwärts wie Schlangen, sondern sie bewegen sich wie ein Regenwurm, also ziehharmonikaartig fort. Ihr verstärkter Schädel ist zum Kopfgraben gut geeignet.
Die ausgestorbene Art sei wahrscheinlich mit heute lebenden Schachbrett-Doppelschleichen verwandt, meint Georgalis. Diese Art lebt, wie alle derzeitigen Doppelschleichen, vor allem unter der Erde, und ist nur selten an der Oberfläche zu sehen. Die neu entdeckte Art Terastiodontosaurus marcelosanchezi hingegen könnte aufgrund ihrer Größe ein Oberflächen-Bewohner gewesen sein.
Besondere Aufmerksamkeit schenkte das Forschungsteam den Zähnen der Echse. Diese seien stark genug gewesen, um eine Vielzahl von Schnecken zu zerquetschen. «Man muss sich vorstellen, dass die Schnecke zwischen die Zähnchen manövriert wurde, und dann hat Terastiodontosaurus hart zugebissen und das Gehäuse einfach geknackt, um an die Leckereien zu kommen», erläutert Smith. Schließlich sei alles verschluckt worden.
Kräftigerer Biss als der eines Hermelin
Auffällig ist der Studie zufolge auch die große Zahnschmelzdicke - die so in noch keiner anderen Doppelschleichen-Art gefunden worden sei. Die Beißkraft von Terastiodontosaurus marcelosanchezi wird auf fast 17 Newton an der Kieferspitze und 25 Newton am größten Zahn geschätzt, wie es in der Studie heißt. Smith erklärt, dass die Beißkraft damit jene der Marder-Art Hermelin übertreffe.
"Rein optisch kann man sich das Tier wie einen Sandwurm aus den Science-Fiction-Romanen und deren Verfilmung 'Dune' vorstellen", meint Erstautor Georgalis. Allerdings lebte die Doppelschleiche nicht in einer wüstenartigen Landschaft, sondern in einer tropischen Umgebung. Es habe damals dort Seen und Flüsse sowie eine vielfältige Fauna auch mit Affen gegeben, erklären die Forschenden.