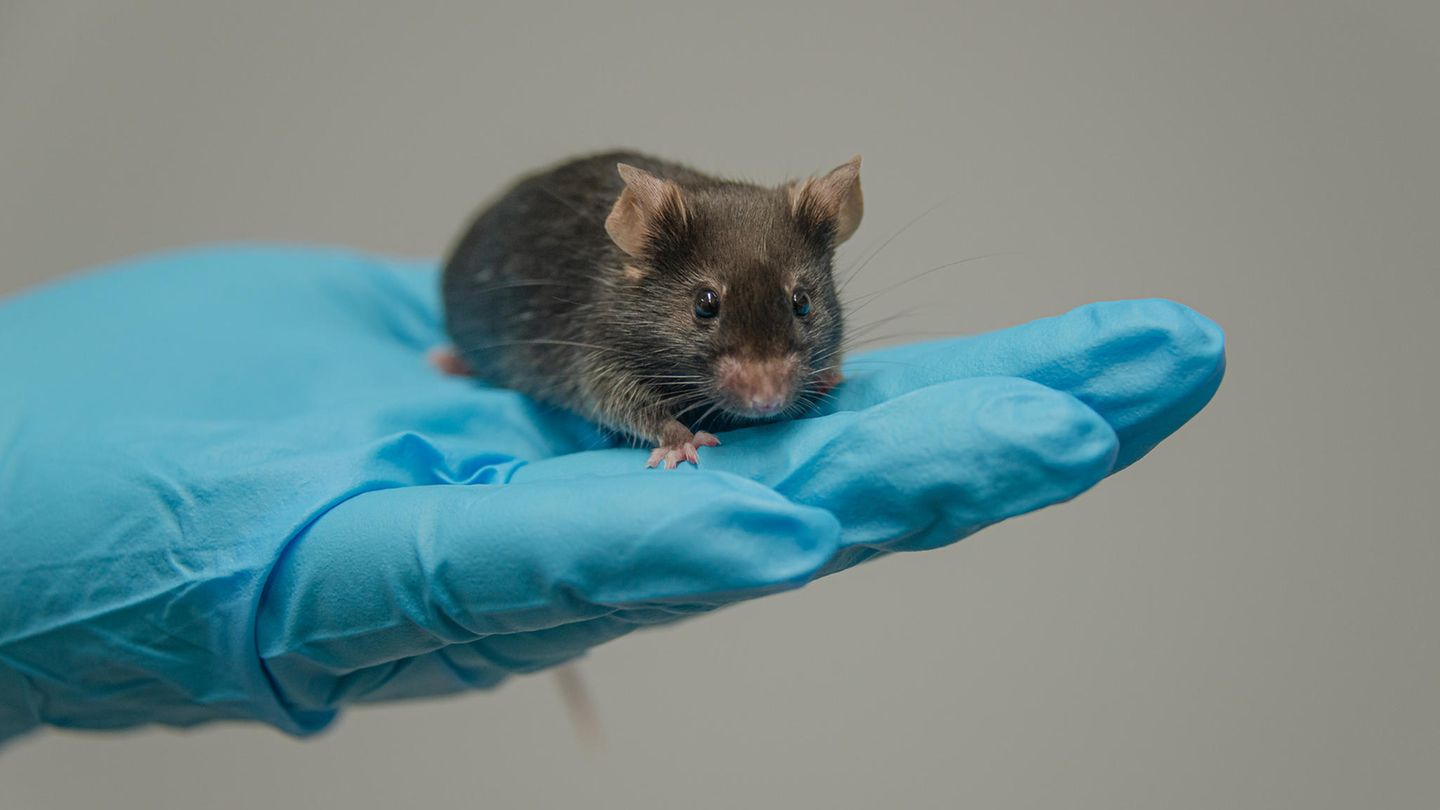Wenn am Montagmorgen der Blick in den Spiegel fällt, kann der Anblick des eigenen Ichs schon mal einen Schreck auslösen. Zumindest dann, wenn man sich selbst im Spiegel wiedererkennt – was Menschen in der Regel selbst nach einem harten Wochenende gelingt. Die meisten Tierarten hingegen erkennen ihr Gesicht nicht wieder. Sie schenken ihrem Spiegelbild keine weitere Beachtung oder beäugen es neugierig, ohne aber ein Zeichen des Wiedererkennens zu zeigen. Manche reagieren sogar panisch und bekämpfen den vermeintlichen Rivalen, der plötzlich vor ihnen steht.
Einige wenige Tierarten verstehen jedoch, dass sie selbst von der spiegelnden Oberfläche reflektiert werden, sind sich also in gewisser Weise ihrer selbst bewusst. Dazu gehören einige Affenarten wie Orang-Utans, Schimpansen, Rhesusaffen und Bonobos. Aber auch Krähen, Asiatische Elefanten und – unter bestimmten Bedingungen – Hähne.
In diese Reihe gliedern sich nun auch Mäuse ein. Laut einer im Fachmagazin "Neuron" veröffentlichten Studie bestehen auch sie den Spiegeltest: Forschende der University of Texas malten Mäusen mit schwarzem Fell einen weißen Punkt auf die Stirn und setzten sie vor einen Spiegel. Bei diesem Anblick begannen die Tiere, ihren Kopf ausgiebig zu putzen, ganz so, als wollten sie ihn von dem Farbklecks befreien. Die Forschenden werten das als Hinweis darauf, dass sich die Tiere im Spiegel selbst erkennen.
Mit dem klassischen Markertest wird schon seit den 1970er-Jahren bei verschiedenen Tierarten überprüft, ob sie sich im Spiegel erkennen – und ob sie damit möglicherweise ein Selbstbewusstsein haben. Auch beim Menschen wurde er schon angewendet: Kleinkinder bestehen den Test erst ab einem Alter von zwei Jahren.
Sozialisation mit Artgenossen spielt eine Rolle
Anders als bei Kindern funktioniert die Wiedererkennung bei Mäusen allerdings nur unter bestimmten Bedingungen: Die Tiere müssen an Spiegel gewöhnt sein und der Tintenklecks auf ihrem Kopf relativ groß. Und: Sie müssen zuvor mit Mäusen sozialisiert worden sein, die ihnen ähnlich sehen. Sozial isolierte Mäuse bestehen den Test ebenso wenig wie Mäuse mit schwarzem Fell, die von weißen Mäusen aufgezogen wurden.
Das könnte neuronale Ursachen haben: Die Forschenden identifizierten eine Untergruppe von Neuronen im zentralen Hippocampus, die dann aktiviert wird, wenn sich die Tiere selbst erkennen. Frühere Studien am Menschen haben gezeigt, dass diese Region bei der Verarbeitung und Speicherung visueller Merkmale des Selbst eine Rolle spielt. Bei den Mäusen scheint das ähnlich zu sein: Sobald die Forschenden diesen Teil des Gehirns mithilfe von Medikamenten ausschalten, gelingt es den Tieren nicht mehr, sich im Spiegel zu erkennen.
Ein Teil der Neuronen, die für das Wiedererkennen zuständig sind, wird bei Mäusen auch dann aktiviert, wenn ihnen Artgenossen mit einem ähnlichen Aussehen begegnen. Isolierte Mäuse oder solche, die von andersfarbigen Tieren aufgezogen wurden, entwickeln diese Neuronen hingegen nicht. Die Forschenden schließen daraus, dass die Tiere soziale Erfahrungen mit Artgenossen machen müssen, um die neuronalen Schaltkreise für die Selbsterkennung zu entwickeln.
Wie empfindsam sind Mäuse?
Dass ausgerechnet Mäuse zu jenen Tierarten gehören, die sich selbst erkennen, könnte durchaus zu Diskussionen führen. Schließlich sind vor allem sie es, die in Tierversuchen eingesetzt werden – nicht nur, weil sie wenig Platz brauchen und sich schnell vermehren. Sondern auch, weil ihnen eine geringere Intelligenz und Leidensfähigkeit zugeschrieben wird als etwa einem Schimpansen. Und je empfindungsfähiger ein Lebewesen ist, so die Logik, desto schützenswerter ist es.
Ob die Studie etwas an der Sicht auf Mäuse ändert, ist bislang offen. Die Autoren betonen jedoch, dass die Tatsache, dass Mäuse eine Veränderung ihres eigenen Aussehens wahrnehmen, nicht notwendigerweise bedeutet, dass sie sich ihrer selbst bewusst sind.
Es braucht also weitere Forschung. Dafür sollen visuelle Reize künftig stärker von taktilen Reizen getrennt werden, also von Reizen, die durch Druck, Berührung oder Temperatur ausgelöst werden. Denn zwar reagierten die Mäuse in der Studie nicht auf große schwarze Farbkleckse auf ihrem Kopf, das Putzen wurde demnach nicht durch den taktilen Reiz allein ausgelöst. Als Anstoß für das visuelle Erkennen war er aber offenbar notwendig: Bei einem großen weißen Farbklecks mit mutmaßlich größerem taktilen Reiz wurde geputzt, bei einem kleinen weißen Klecks nicht.
Mithilfe von Technologie können solche Unterschiede feiner getestet werden. Denkbar wäre zum Beispiel der Einsatz von Filtern, wie wir sie aus Social-Media-Apps kennen, die uns virtuell Make-up auftragen oder Hundeohren aufsetzen. So könnte getestet werden, ob sich die Mäuse auch ohne jeglichen taktilen Reiz erkennen. Gleichzeitig sollen weitere Hirnregionen untersucht werden, die möglicherweise an der Selbsterkennung beteiligt sind – und die mit anderen Körperregionen kommunizieren.