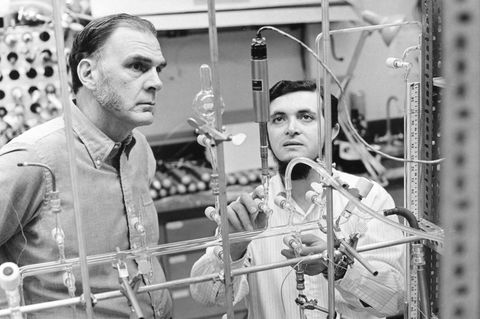Insekten sind für ein Ökosystem unersetzlich: Sie lockern und belüften den Boden, zersetzen Kot und Tierkadaver, vertilgen Schädlinge und bestäuben Bäume, Blumen und Sträucher. Selbst in der Antarktis, deren Oberfläche die meiste Zeit des Jahres von Schnee und Eis bedeckt ist und wo das Thermometer zeitweise auf minus 89,2 Grad fallen kann – der kälteste Wert, der je auf der Erde gemessen wurde – leben Insekten. Genauer gesagt eine einzige, dort heimische Insektenart: die Antarktische Mücke (Belgica antarctica) aus der Familie der Zuckmücken. Mit ihren zwei bis sechs Millimeter Körpergröße ist sie gar das größte dauerhaft auf dem Kontinent lebende Landtier – andere Bewohner wie der Kaiserpinguin verweilen nur zeitweise auf dem antarktischen Festland und ziehen sich dann wieder aufs umgebende Packeis und in die Gewässer zurück, durch die auch Säugetiere wie die Weddelrobbe und der Seeleopard jagen.
Nicht so die Antarktische Mücke, eine echte Überlebenskünstlerin in Schnee und Eis: Ihre Larven können mehrere Wochen ohne Sauerstoff auskommen, fast vollständig austrocknen und sogar lebendig einfrieren. Letzteres könnte das Geheimnis ihres Überlebens in der extremen Kälte sein, hat ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Osaka-Metropolitan-Universität nun herausgefunden: Demnach übersteht das flügellose Insekt seinen zweijährigen Lebenszyklus, indem es sich perfekt an die Temperaturschwankungen in der Antarktis anpasst – und während der beiden Winter im Larvenstadium zwei verschiedene Formen einer Ruhepause einlegt. "Wir konnten eine Methode zur Aufzucht der antarktischen Mücke über einen Zeitraum von sechs Jahren entwickeln, um einige ihrer Anpassungsmechanismen an die Umwelt zu erforschen", sagt Co-Autorin Mizuki Yoshida in einer Mitteilung der Universität.
Offenbar entwickelt sich die Larve der Antarktischen Mücke vor ihrem ersten Winter bis zum zweiten Entwicklungsstadium und legt mit Wintereinbruch als unmittelbare Reaktion auf die lebensfeindlichen Bedingungen eine Ruhepause ein. Sobald im Frühsommer die Temperaturen steigen, wird die Larve wieder aktiv und setzt ihre Entwicklung fort. Noch vor dem zweiten Winter erreicht sie so ihr viertes und letztes Entwicklungsstadium, ohne sich jedoch zu verpuppen. Den zweiten Winter übersteht das Tier in der sogenannten obligaten Diapause, einer genetisch bedingten, natürlich eingeleiteten Ruhepause zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lebenszyklus, in der die Entwicklung gestoppt und der Stoffwechsel unterdrückt wird.

Nur wenige Tage zur Paarung und Fortpflanzung
Im Sommer schlüpft die Mücke dann als erwachsenes Tier und hat keine Zeit zu verlieren: In den sieben bis zehn Tagen, die ihr jetzt noch zum Leben bleiben, muss sie einen Partner finden, sich paaren und Eier legen. Damit die Fortpflanzung in der kurzen Lebensspanne der Mücke gelingt, ist es wichtig, dass alle Tiere zur gleichen Zeit im Sommer schlüpfen.
"Wir haben festgestellt, dass die obligate Diapause bei der Antarktischen Mücke mit dem Einsetzen niedriger Temperaturen im Winter endet, sodass sich alle Larven gleichzeitig verpuppen und gleichzeitig als erwachsene Tiere schlüpfen", sagt Co-Autor Shin Goto. Solche saisonalen Anpassungsstrategien, die eine mehrfache Überwinterung in Ruhe und eine obligate Diapause beinhalten, sind bisher von keinem anderen Organismus bekannt. Die Forschenden vermuten jedoch, dass Insekten, die in ähnlich rauen Umgebungen wie der Arktis oder in großen Höhen leben, ähnliche Strategien anwenden könnten.