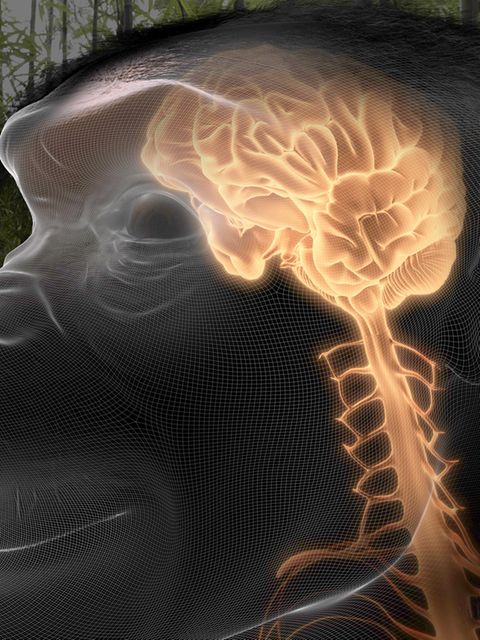Der Handel mit wilden Tieren – als Medizin oder Delikatesse – hat in asiatischen Ländern Tradition. Doch der exotische Fleischgenuss könnte nun ein Ende finden - zumindest in China. Dessen Staatsführung hat am 26. Januar bis auf Weiteres alle Wildtiermärkte verboten.
Der Grund: Laboruntersuchungen des neuartigen Coronavirus 2019-nCoV haben Hinweise darauf ergeben, dass der Erreger sich ursprünglich nicht im Menschen entwickelt hat – sondern in Wildtieren. Sogar der genaue Ort ihrer Entstehung konnte identifiziert werden: Ein Fischmarkt in der Stadt Wuhan, auf dem auch Dutzende Arten von Wildtieren zum Kauf angeboten wurden.
Nicht alle dieser Tiere sind Wildfänge. Die chinesische Regierung erlaubt die Zucht und den Verkauf von insgesamt 54 Wildtierarten, etwa Strauße, Nerze, Schildkröten und Krokodilen. Besonders wohlhabende Städter leisten sich Delikatessen wie eine Suppe aus der Schleichkatzenart Fleckenmusang, frittierte Kobra oder geschmorte Bärentatze.
Die Bedingungen für die Entstehung von neuartigen Erregern sind auf Wildtiermärkten ideal: "Es ist kaum möglich, perfektere Bedingungen für die Bildung von neuen Viren zu schaffen", schreibt etwa die in New York ansässige Wildlife Conservation Society (WCS) auf ihrer Homepage. Ausscheidungen und Blut von verschiedenen Arten von Wild- und Farmtieren, die auf engstem Raum, gestresst und immungeschwächt eingesperrt sind und zum Teil vor Ort geschlachtet werden, böten ideale Bedingungen für die Übertragung von Tier zu Tier – und schließlich auf den Menschen. Neueste Forschungen deuten auf Fledermäuse als Ursprung des Virus hin. Über bislang unbekannte Zwischenwirte, etwa andere Säugetiere, erfolgte die Übertragung auf Menschen.
Der WCS fordert darum, zusammen mit weiteren Tier- und Naturschutzorganisationen, ein komplettes Verbot solcher Märkte. Es sei sonst nur eine Frage der Zeit, so Christian Walzer, bei der WCS zuständig für Tiergesundheit, dass ein neuer Erreger entstehe und ausbreche.
Viele gefürchtete Infektionskrankheiten stammen von Tieren
Experten sprechen bei Infektionskrankheiten, die vom Tier auf Menschen übertragen werden können, von Zoonosen. So entstand das HI-Virus (Aids) in den 80er-Jahren in Affen, die in Westafrika als günstiges "Bushmeat" angeboten und verzehrt worden waren. Hochrechnungen zufolge werden allein in Ghana jedes Jahr 380.000 Tonnen Wildtierfleisch verspeist.
Zwischen 2004 und 2007 grassierte dann weltweit das Virus H5N1, das später als Vogelgrippe berüchtigt wurde – weil es sich durch wild lebende Wasservögel, aber auch durch Hausgeflügel ausbreitete. Allein in Deutschland wurden Hunderttausende Tiere vorsorglich getötet, weltweit starben mehr als 450 Menschen. 2009 folgte die Schweinegrippe. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass das neuartige Coronavirus sich in Fledermäusen entwickelt hat, stünde es in einer Reihe mit Ebola und SARS.
Weltweit werden jedes Jahr bis zu drei neue solcher Zoonosen entdeckt. Und die Rolle von Wildtiermärkten bei der Entstehung und Verbreitung von neuartigen Erregern ist seit Jahren bekannt. So erließ die chinesische Regierung auch auf dem Höhepunkt der SARS-Epidemie im Jahr 2003 ein Verbot des Wildtierhandels – hob es allerdings sechs Monate später wieder auf.
Dass die chinesische Staatsführung jetzt entschlossen durchgreift, weist voraus auf die 15. UN-Biodiversitäts-Konferenz, die im Oktober in Kunming stattfinden wird. Denn neben den katastrophalen Haltungsbedingungen auf Wildtiermärkten, die Tierschützer immer wieder kritisieren, ist der Handel mit wild gefangenen Tieren auch eine Gefahr für die weltweite Artenvielfalt. Experten zufolge sind weltweit fast 9000 Spezies durch illegalen Handel in ihrer Existenz bedroht. Wildtiere werden in China, aber auch in weiten Teilen Südostasiens, entweder als Nahrungsmittel, Heilmittel für die Traditionelle Chinesische Medizin, Trophäen oder Haustiere gefangen und gehandelt.
Zur Zeit gibt es zumindest Indizien dafür, dass die Regierung das Verbot entfristen könnte, denn die öffentliche Meinung zum Thema Wildtierhandel in China kippt. So wird in den (staatlich zensierten) sozialen Medien die Forderung nach einem Verbot tausendfach geteilt und verbreitet. Und die Zeitung China Daily warnte kürzlich in einem Leitartikel mit Blick auf die Entstehung des Erregers: "Wir sollten nicht Fledermäuse anklagen – sondern Wildtiermärkte, Restaurants und gefräßige Menschen." Wenn es nicht gelinge, den Handel mit Wildtieren vollständig zu unterbinden, drohten schlimmere Epidemien.