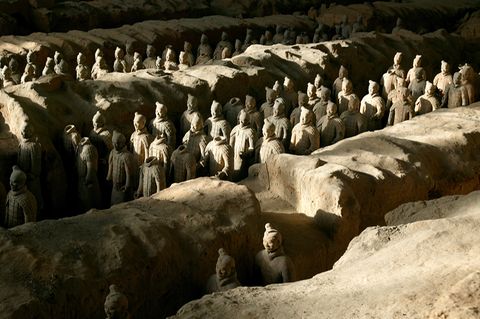War es säureätzende Ironie oder eine besonders blinde Form von Gehorsam? Als Beijing Ende Februar unter einer Smogwolke verschwand, stellte sich Konteradmiral Zhang Zhaozhong im Staatsfernsehen hin und erklärte, dass die atemraubende schwarze Suppe, die durch die Straßen trieb, doch auch ihr Gutes habe: Die Luft sei nämlich so sehr mit Schwermetallpartikeln gesättigt, dass sie gleichsam einen Schild bilde, mit dem sich feindliche Laserstrahlen abblocken ließen. Der Smog bewahre die Hauptstadt also effektiv vor Angriffen aus der Luft.
Der Konteradmiral Zhang hätte dann gleich noch darauf hinweisen können, dass der Kohlegürtel, der sich nördlich der Hauptstadt durch die Provinzen Innere Mongolei, Shaanxi, Shanxi und Hebei spannt, Beijing auch zu Land vor einer Invasion zu schützen vermag - wirksamer, als es die chinesische Mauer je konnte, die dort ebenfalls verläuft.
Albtraumlandschaft an der Grenze zu Russland
Denn wer auch immer die Grenze zu China von der Mongolei oder Russland aus überquert, stößt in diesen vier Provinzen auf eine Albtraumlandschaft. Wo früher Nomaden mit Schafherden über die Weiden zogen, klaffen heute gigantische Löcher im Boden, über hundert Meter tief und manchmal kilometerbreit. Kolonnen von Schwertransportern winden sich an ihren Seiten in Serpentinen in die Tiefe, um am Grund Kohle aufzuladen und zu den umliegenden Kokereien zu bringen. Andere Gegenden sind mit runden Erdtrichtern übersät. Unter Tage sind dort Bergwerksstollen eingestürzt und haben die Oberfläche mit Fallen versehen.
Es war Mao Zedong, der in den 1950er Jahren angeordnet hatte, einen Großteil der Schwerindustrie im Norden Chinas anzusiedeln. Zum einen, weil Kokereien, Hochöfen und Chemiefabriken dort nahe den Kohlevorräten gebaut werden konnten, was die Transportwege verkürzte. Zum anderen, weil Mao die industrielle Versorgung im Kriegsfall sicherstellen wollte, sollten die Küsten von den USA und Taiwan angegriffen werden. Nach der Liberalisierung der Wirtschaft in den 1990er Jahren vervielfachte sich die Zahl der Fabriken in der Gegend. 1990 produzierte China nur 66 Millionen Tonnen Stahl, 2013 waren es bereits 779 Millionen Tonnen, fast die Hälfte der Weltproduktion. Und der Sektor wächst weiter, mit bis zu zehn Prozent pro Jahr.
China verfeuert die Hälfte der weltweit geförderten Kohle
Weil das Land über keine ausreichenden Öl- oder Gasvorkommen verfügt, aber eben über riesige Flöze in den Ebenen der Inneren Mongolei und der angrenzenden Provinzen, verheizt es rund die Hälfte der weltweiten Kohleproduktion: insgesamt 3,8 Milliarden Tonnen waren es im Jahr 2012. 70 Prozent der Energie werden landesweit durch Kohleverbrennung gewonnen. Und bis zum Jahr 2015 sollen 16 weitere gigantische Kraftwerke dazukommen, die meisten davon im Kohlegürtel. Mensch wie Natur zahlen den Preis dafür: Der Kohlebergbau verschlingt enorme Mengen an Wasser. Allein die 16 neuen Kraftwerke werden nach einer Greenpeace-Schätzung zehn Milliarden Kubikmeter Wasser im Jahr benötigen - und das in einer Gegend, die schon heute unter großer Dürre leidet und immer weiter versteppt.
Hinzu kommt, dass viele Fabriken ihre Abwässer ungeklärt in die Flüsse leiten oder per Tanklastwagen in die Wüsten befördern und dort ablassen. Die Folge: Mehr als 50 Prozent des Grundwassers in China sind als „verschmutzt“ eingestuft. Und eingetrocknete Seen sind oft mit einer Schicht chemikalischer Rückstände überzogen, die in den Farben des Regenbogens funkeln.Der aufgewirbelte Staub aus der Wüste Gobi verbindet sich mit dem Ruß der Kraftwerke, dem Schwefeldampf der Kokereien und den giftigen Abgasen der Chemiefabriken zu einer toxischen Melange, die im Winter und Frühjahr weite Teile Chinas bedeckt.
Absurde Feinstaubkonzentrationen
An jenem Tag, an dem sich Konteradmiral Zhang tapfer vor die Mikrofone stellte, überschritt die Feinstaub-Konzentration in Beijing die Marke von 500 Mikrogramm pro Kubikmeter - 50-mal mehr, als die Weltgesundheitsorganisation als Höchstwert erlaubt. Beim Queren einer vierspurigen Straße konnten die Beijinger nicht mehr von einem Bürgersteig zum gegenüberliegenden sehen.
Laut einer im englischen Medizin-Fachblatt "The Lancet" veröffentlichten Studie kostet dieser Smog jedes Jahr bis zu einer halben Million Chinesen das Leben. Im Nordosten der Volksrepublik reduziert er die Lebenserwartung der Menschen im Durchschnitt um fünfeinhalb Jahre.
China-Experten schreiben gern, dass es eine Art Abkommen zwischen der Kommunistischen Partei und dem Milliardenvolk gebe: Solange die Wirtschaft floriere und es den Menschen immer besser gehe, seien sie bereit, auf ihre Freiheit zu verzichten. Für steigenden Wohlstand haben die Chinesen gleichsam das Recht abgegeben, frei zu wählen, sich frei zu versammeln und sich frei auszudrücken. Noch nicht aber: frei zu atmen.