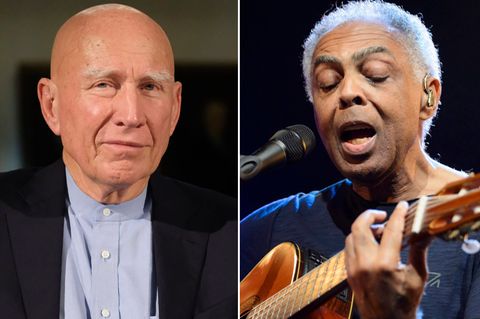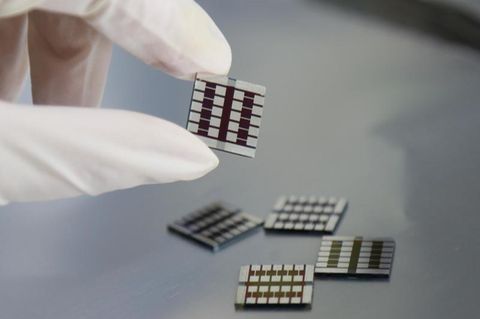Während sich Industrieländer verstärkt mit Umweltthemen auseinandersetzen, steht bei Entwicklungsländern zuallererst wirtschaftliches Wachstum im Vordergrund. Südkorea versucht mit seiner "Green Growth"-Strategie einen Mittelweg einzuschlagen: Wirtschaftliches
Wachstum hat weiterhin Priorität, soll aber mit "grünen", sprich sauberen
Technologien erreicht werden.
Präsident Lee Myung-bak präsentierte erstmals im August 2008 während der Feiern zum 60-jährigen Bestehen Südkoreas seine "Low Carbon, Green Growth"-Strategie. Mit erneuerbaren Energien soll die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und der CO2-Ausstoß reduziert werden. Weiteres Ziel ist es, im grünen Sektor neue Jobs zu generieren. Dafür investiert die Regierung bis 2013 knapp 60 Millionen Euro.

Auch wenn die Investitionen der Regierung für das grüne Wachstum
insgesamt zwei Prozent des Bruttosozialprodukts ausmachen, plant Südkorea
erstmal in kleinen Schritten: Ziel ist es, bis 2030 einen Ökostromanteil
von elf Prozent zu erreichen und die CO2-Emissionen bis 2020 im Vergleich
zu 2005 um gerade mal vier Prozent zu reduzieren. Weiterhin will
Südkorea, das einen Großteil seiner Lebensmittel aus dem Ausland
importieren muss, die Nahrungsmittelsicherheit des Landes verbessern.
Laut einer OECD-Studie von 2005 rangiert das Land am Hanfluss
diesbezüglich unter 30 OECD Ländern lediglich auf dem 25. Platz.
Im Rahmen der Green-Growth-Politik nimmt Südkorea auch sein größtes
Bauprojekt aller Zeiten auf: das Vier-Flüsse-Projekt, an dem sich die
Geister im Lande scheiden. Befürworter des 18-Milliarden-Dollar-Projekts
meinen, dass durch die Restaurierung der vier großen Flüsse des Landes
die Wasserqualität verbessert und künftige Flutschäden verhindert werden
können. Außerdem sollen über 300.000 neue Arbeitsplätze durch das
Mammutprojekt generiert werden. Kritiker befürchten jedoch eine riesige
Umweltkatastrophe, da Lebensräume zerstört würden und dem Ökosystem
irreparablen Schaden zugefügt würde.
Repräsentatives Aushängeschild der "Green Growth"-Politik ist das am 16.
Juni 2010 gegründete Global Green Growth Institute (GGGI), das sich zur
Aufgabe gemacht hat, Technologien zur Schadstoffreduktion und erneuerbare
Energien voranzutreiben. Weltweit soll das Green-Growth-Konzept
propagiert werden - mit Südkorea als Vorreiterland.
Der ehemalige südkoreanische Premierminister Han Seung-soo setzt sich
bereits seit Jahren für eine nachhaltige Umweltpolitik in Südkorea und
der Welt ein. Mittlerweile ist er Vorstandsvorsitzender des Global Green Growth Instituts in Seoul. "Südkorea ist eines der wenigen Länder, das in den letzten 50 Jahren so einen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg erlebt hat", sagt der 74-jährige Han über sein Heimatland, welches als weltweit erstes Land vom Nehmer- zum Geberland aufgestiegen ist. Zählte Südkorea nach dem Koreakrieg im Jahr 1953 noch zu den ärmsten Ländern der Welt, so
gehört es mittlerweile zu den 15 größten Volkswirtschaften.
"Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum gingen Hand in Hand, aber
gleichzeitig wurde dabei die Umwelt vernachlässigt", erklärt Han, der
neben seiner politischen Laufbahn auch als Professor an der Staatlichen
Universität Seoul tätig war. Für den renommierten Ökonomen deshalb
logisch, das die südkoreanische Regierung als erstes Land weltweit, das
grüne Wachstumsparadigma in ihre nationale Planungspolitik aufgenommen
hat.
Ziel des Global Green Growth Institutes ist es, bis 2012 Koreas erste
Umweltorganisation von internationaler Bedeutung zu werden. Dafür werden
weltweit Kooperationen forciert, im Besonderen mit Entwicklungsländern:
"Wir haben die Kapazitäten und das Potenzial, das anderen Ländern fehlt.
Deshalb exportieren wir unsere Ideen in Entwicklungsländer", sagt der
emeritierte Professor Han.
Die Arbeit des Green Growth Institutes im Ausland hat bereits konkrete
Formen angenommen: In Abu Dhabi und Kopenhagen wurden im Frühjahr dieses
Jahres Zweigstellen eröffnet. In den Vereinigten Arabischen Emiraten will
das GGGI eine "Green Growth Plan"-Analyse durchführen und die Senkung der
Treibhausgasemissionen fördern. Ebenfalls bietet es Schulungsprogramme
an, bei denen Arbeitskräfte über ökologisches Wachstum aufgeklärt werden.
Aus Australien und Japan sei ebenfalls Kooperationswille signalisiert
worden. Beide Länder wollen das Institut finanziell unterstützen.
Doch es gibt auch Kritiker der koreanischen Green-Growth-Strategie:
Heimische Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bezeichnen die Strategie
der Lee Myung-bak Administration als Augenwischerei. Sie kritisieren,
dass die Kernenergie zentraler Bestandteil des Modells ist. Das Land
setzt immer mehr auf Atomkraft. Südkorea will den eigenen Strombedarf bis
2030 zu über 40 Prozent aus nuklearer Energie decken. Im Moment sind es
23 Prozent. Vor allem aber will die Regierung die Technologie auch ins
Ausland verkaufen. In den kommenden Jahren soll Südkorea unter die Top
drei der Atomkraftwerksexportnationen aufsteigen. Atomenergie soll die
südkoreanische Abhängigkeit von Energieimporten verringern und den
CO2-Ausstoß verringern.
"Natürlich gibt es besonders nach Fukushima immer mehr Zweifel an
Nuklearenergie. Aber um mit dem Klimawandel auf globaler Ebene fertig zu
werden und fossile Brennstoffe zu reduzieren, müssen viele Länder an
Atomenergie festhalten - gerade auch, wenn man den derzeitigen
Entwicklungsstand erneuerbarer Energien berücksichtigt", meint Lee
Hyung-woo, Sprecher des Präsidentiellen Komitees für Green Growth.
"Wie kann Nuklearenergie eine saubere Energie sein, wenn es bisher keine
Lösung für die Entsorgung des radioaktiven Abfalls gibt?", fragt sich da
Lee Yu-jin, die Direktorin für Klimawandel und Energie bei Green Korea
United. Green Korea United ist eine koreanische NGO, die sich "echtes"
grünes Wachstum auf die Fahnen geschrieben hat. Denn für die
Umweltorganisationen stellt der koreanische Weg ein Paradoxon dar. Die
von der Regierung propagierte Alternativlosigkeit der atomaren
Green-Growth-Strategie wollen die Umweltschützer nicht akzeptieren. Das
von ihnen oft ins Feld geworfene Argument "Fukushima" lassen die
koreanischen Fachleute aber nicht gelten.