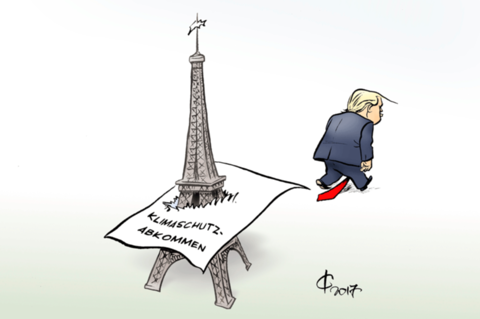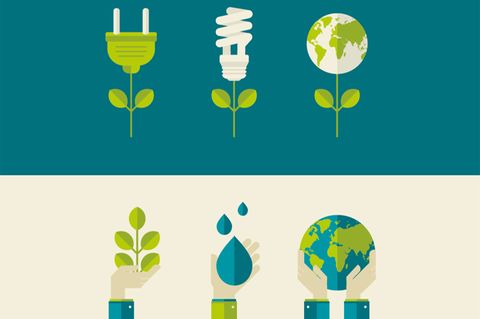Samstagnachmittag, 15:30 Uhr. Bundesliga. Wie ist die Lieblingsmannschaft drauf? Stimmt die Leistung? Hat der Gegner einen spektakulären Neuzugang? Solche Fragen beschäftigen Fußball-Fans.
Aber Energieverbrauch? Nachhaltigkeit? CO2-Fußabdruck?
Dabei lohnt sich ein Blick auf die Klimabilanz der schönsten Nebensache der Welt:
- Das größte der 18 deutschen Stadien der ersten Liga, der Signal Iduna Park in Dortmund, fasst mehr als 80.000 Besucher und verbraucht nach BVB-Angaben im Spielbetrieb bis zu 3,5 Megawatt elektrische Energie - so viel wie eine kleine Fabrik.
- In der Saison 2009/10 fuhren durchschnittlich 42.000 Zuschauer zu den Spielen der Bundesliga. Und wieder zurück. Insgesamt waren es 17,4 Millionen Besucher.
- Im Winter werden die Plätze der 1. und der 2., teilweise sogar der 3. Liga mit Rasenheizungen eisfrei gehalten. Oft muss das Grün sogar noch mit einer speziellen Lichtanlage beleuchtet werden - damit es grün bleibt.
- Allein die Damen-WM 2011 in Deutschland verursachte geschätzte 41.000 Tonnen Treibhausgas-Emissionen.
Das Thema Energiesparen im Fußball hat Potenzial. Und darum steht es spätestens seit der WM 2006 auf der Agenda des Weltfußballs. Damals rief der Weltfußballverband Fifa die "Green-Goal"-Initiative ins Leben. Ziel waren vor allem eine Senkung des Energieverbrauchs in den zwölf WM-Stadien, ein sparsamer Umgang mit Ressourcen und die Vermeidung von Müll. Statt in Einwegbechern schenkten die Caterer ihre Getränke in Pfandbechern aus. Immerhin, ein Anfang.
Seither hat sich viel getan. Und das aus gutem Grund. Es geht nicht nur um Verantwortung, sondern schlicht um Geld. "Der ökologische Aspekt ist zu einem großen Teil auch ein ökonomischer", sagt Stephan Bandholz, Leiter des Stadionbetriebs in der Mainzer Coface-Arena. Seit drei Monaten ist das Stadion in Betrieb, der Erstligist 1. FSV Mainz 05 schmückt sich mit dem Titel "erster klimaneutraler Bundesligaverein".

Geht doch: "klimaneutraler" Fußball
Möglich macht das ein Nachhaltigkeitskonzept des Öko-Instituts Darmstadt und die Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor, dem Ökostromanbieter Entega. In der neuen Arena gibt es eine Gebäude-Leittechnik, um die Heizung und die Belüftung effizient steuern zu können. Beim Bau wurde darauf geachtet, dass der Rasen auch im Winter genug Licht bekommt. So hoffen Bandholz und sein Greenkeeper auf eine energiefressende Rasenbeleuchtungsanlage verzichten zu können. Die Rasenheizung, die einen eisfreien Spielbetrieb auch im Winter ermöglichen soll, wird mit Fernwärme betrieben. Und sie ist so regelbar, dass nur dort geheizt wird, wo die Wintersonne nicht hinkommt. Der Strom für das Stadion, die Geschäftsstelle, den Fanshop und das Catering kommt vom Ökostromanbieter. "Wir versuchen zuerst, CO2-Ausstoß zu vermeiden. Was wir nicht vermeiden können, kompensieren wir. Etwa durch Aufforstungsmaßnahmen in Kanada", erläutert Bandholz.
Auch andere Stadien rüsten sich für das Zeitalter des Klimawandels. Das Bremer Weserstadion wurde jüngst mit der größten gebäudeintegrierten Photovoltaikanlage Deutschlands ausgerüstet. Sonnenstrom fließt auch von den Dächern der Arenen in Freiburg, Kaiserslautern, Dortmund und Nürnberg. Die Augsburger nutzen in ihrer SGL arena klimaschonende Geothermie, um ihrem Rasen das Wurzelwerk zu wärmen. Der Hamburger SV bezieht seit dem vergangenen Jahr Ökostrom, ebenfalls von Entega. Und nach der laufenden Sanierung soll die Imtech Arena der Hanseaten rund ein Drittel weniger Strom verbrauchen.
Großes Potenzial sieht auch Matthias Buchert bei der Gebäudetechnik. "In den vergangenen fünf Jahren gab es einen großen Schub bei der Stadiontechnik und im Stadionbau", sagt der Berater des Darmstädter Öko-Instituts. Ein Beispiel: Große Stadien haben bis zu 100 VIP-Logen, die im Winter belüftet und beheizt werden können. "Es gab Stadien, da mussten Sie alle Logen gleichzeitig heizen, obwohl vielleicht nur zwei davon genutzt wurden", sagt Buchert. Heute kommen Regelungstechniken zum Einsatz, mit denen sich Heizung und Lüftung einzelner Logen steuern lassen.
Der größte Brocken der CO2-Emissionen, sagt Buchert, fällt allerdings nicht im Stadion an - sondern bei der Anfahrt von Spielern und Fans. Immerhin 81 Prozent der gesamten Klimagasemissionen, prognostizierten Experten, gingen bei der Damen-WM 2011 in Deutschland auf das Konto der Mobilität. Weitet man den Blick auf alle Sportveranstaltungen in Deutschland aus, zeigt sich sogar ein noch krasseres Verhältnis. Der Deutsche Olympische Sportbund geht davon aus, dass der Verkehr für ganze 95 Prozent des Klimagas-Ausstoßes bei Sportevents verantwortlich ist.
"Es macht sehr viel aus, wenn Fans Fahrgemeinschaften bilden oder vom PKW auf die Bahn umsteigen", sagt Matthias Buchert. Oder - noch besser - aufs Fahrrad. Der 1. FSV Mainz 05 erklärte den Tag eines Heimspiels gegen den HSV gleich zum autofreien Sonntag - und bot seinen Fans vor dem Stadion kostenlose Fahrradchecks an. "Das wurde gut angenommen", sagt Stadionleiter Stephan Bandholz. Zudem war die Aktion eine geschickte PR-Maßnahme für den Ökostrom des Sponsors.
Geld schießt Tore
Auf der alternativen Greenpeace-Tabelle landete der 1. FSV Mainz 05 prompt auf dem ersten Platz. Für die Februar-Ausgabe ihres Magazins hatten sich die Umwelt-Aktivisten die Hauptsponsoren der Erstligisten genauer angesehen. Auf dem letzten Platz landete der 1. FC Nürnberg - weil er sich seit 2008 von Areva finanziell auf die Sprünge helfen lässt. Der französische Konzern ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Nukleartechnik. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima geriet der Verein mit dieser Partnerschaft in die Kritik.
Vor allem den Grünen im Nürnberger Stadtrat missfiel das Atom-Logo auf den Trikots der Mittelfranken. Doch sie konnten sich nicht durchsetzen. Die meisten Fans interessiert eher der Auf- oder der Abstieg. Nicht der Ausstieg.
In einer Neuauflage der Tabelle, die in der Oktober-Ausgabe des Greenpeace-Magazins erscheint, ist die TSG 1899 Hoffenheim vom achten Platz an die Tabellenspitze gerückt. Der Grund: Der neue Hauptsponsor ist die chinesische Firma Suntech, Weltmarktführer bei Solarmodulen. Die Greenpeace-Leute haben sich sogar angesehen, wie das Unternehmen arbeitet - und würdigten die hohen Umwelt- und Sozialstandards in der Produktion sowie die große Transparenz. Allerdings sei die Tabelle "mit einem Augenzwinkern" zu lesen, sagt Wolfgang Hassenstein, Redakteur beim Greenpeace-Magazin. "Wir haben nicht die Ökobilanz des ganzen Unternehmens errechnet." Strahlendes Schlusslicht bleibt Nürnberg.

Mit mehr oder weniger fragwürdigen Sponsorengeldern haben die kleinen Vereine abseits des Bundesliga-Zirkus weniger Probleme. Und doch sind sie einer der wichtigsten Schlüssel zu einem effektiven Klimaschutz im Fußball. "In der Summe sind die Tausenden kleinen Vereine wichtiger als die großen", sagt Matthias Buchert.
Sanierungsstau in der Provinz
Der Landessportbund Rheinland-Pfalz warnt, dass knapp 70 Prozent aller Sporthallen und Sportplätze in Deutschland "dringend auf Vordermann gebracht" werden müssten. Die Kosten für die fälligen Sanierungen beziffert der Deutsche Olympische Sportbund auf satte 42 Milliarden Euro. Vor allem fehle es an zeitgemäßer Wärmedämmung, energieeffizienten Heizungsanlagen und Kühlgeräten. Gleichzeitig steht vielen Vereinen finanziell das Wasser bis zum Hals. "Die Energiekosten sind horrend gestiegen", sagt Jens Prüller vom Landessportbund Hessen. Viele Anlagen seien heute in einem Zustand, dass die Vereine um eine Sanierung einfach nicht mehr herumkommen. "Und wenn schon sanieren, dann doch bitte gleich energetisch sinnvoll."
Prüller ist zuständig für 7800 hessische Sportvereine, 2000 Beratungen haben er und seine Kollegen schon durchgeführt. Bei seinen Ortsterminen findet er in der Regel ein "Sammelsurium älterer Anlagen" vor. "Und die sind auch nicht immer fachmännisch konzipiert", sagt der Energie-Experte. Mit einer fachgerechten Dämmung des Vereinsheims und einer modernen Heizungsanlage seien bei den Heizkosten Einsparungen von bis zu 70 Prozent möglich, sagt Prüller.
Vielleicht sorgen finanzielle Anreize und die leuchtenden Beispiele der energieschonenden Promi-Arenen auch in der Provinz bald für eine Effizienzwende. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jedenfalls ist entschlossen, in Sachen CO2-Reduzierung weiter voranzugehen. Präsident Theo Zwanziger hat das Thema jüngst zur Chefsache erklärt. Er sieht den Fußball gar als "Vorreiter einer neuen Nachhaltigkeitskultur".
Die DFB-Nachhaltigkeitskommission bastelt derweil an einer Umwelt-Kampagne. Der Startschuss soll Ende Februar 2012 fallen, beim Länderspiel gegen Frankreich. Austragungsort ist das Bremer Weserstadion. Die Leistung der hier installierten Solarmodule reicht rechnerisch, um 300 Haushalte mit erneuerbarem Strom zu versorgen. Oder die stadioneigene Anlage für die Rasenbeleuchtung.
Der DFB-Öko-Leitfaden
Die Initiative "Klimaschutz im Sport" des Deutschen Olympischen Sportbundes
Das Greenpeace-Magazin 6.11 mit der neuen alternativen Bundesliga-Tabelle