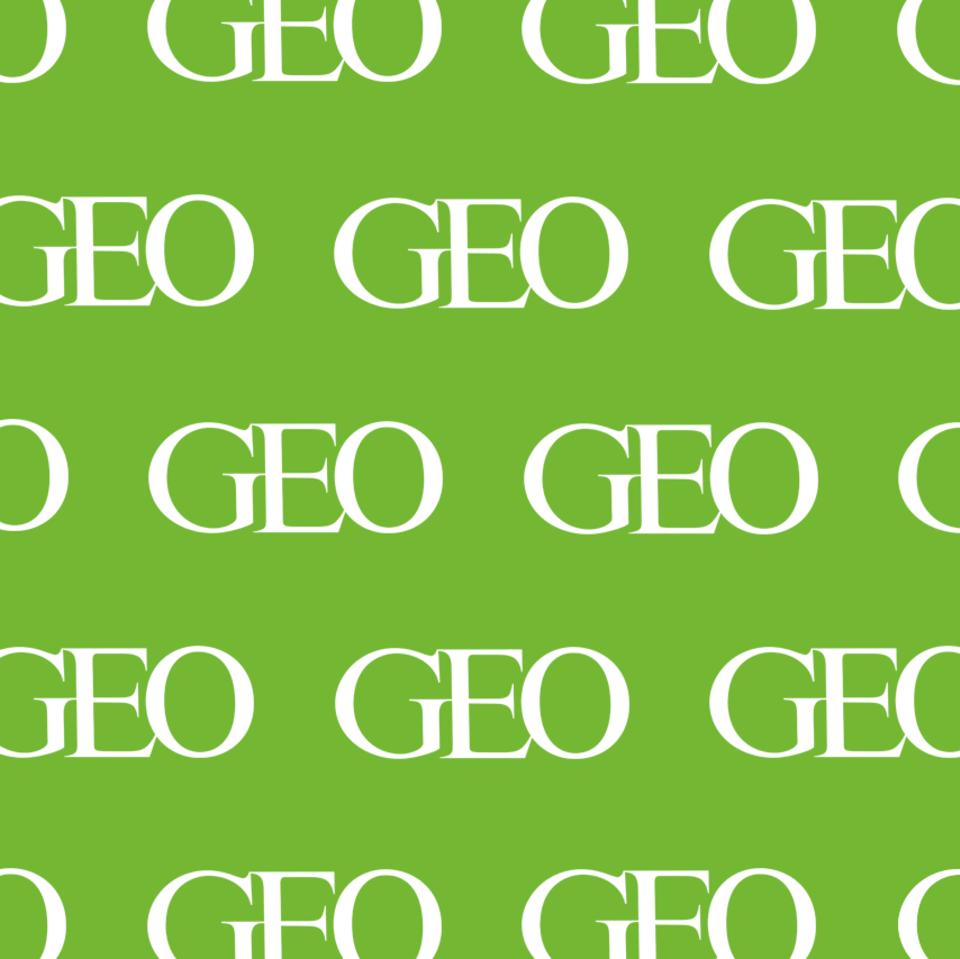GEO: Sie haben bereits 1999 ein Konzept vorgetragen, um die Stromversorgung für Europa zu revolutionieren. Mit "Desertec" hat die Münchener Rück Teile Ihrer Idee aufgegriffen. Freuen Sie sich? Gregor Czisch: Ja und nein. Mir ging und geht es um die Vollversorgung aus erneuerbaren Energien für eine Milliarde Menschen zwischen Island und Saudi-Arabien, in die alle Alternativenergien einfließen. Das Desertec-Projekt setzt mir zu einseitig auf Solarenergie. Es gibt ja auch hervorragende Windpotenziale in Afrika. Die starken Sommerwinde sind eine ideale Ergänzung zu den Winterwinden in Nordeuropa. Die Stromerzeugung aus diesen kombinierten Standorten wäre sehr viel billiger als die Solarenergie und auch schneller zu realisieren.

Ihre Idee ist also ein Verbundnetz für Windkraft von der deutschen Küste, Biomasse aus Polen, Solarenergie aus dem Mittelmeerraum ...? Jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Durch den großräumigen Austausch lassen sich regionale und saisonale Schwankungen ausgleichen. Man wird effizienter und braucht im Prinzip nur noch ganz wenig Speicherung. Für den Transport sorgen wie bei Desertec sogenannte HGÜ-Leitungen, die mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung arbeiten und viel weniger Energieverluste haben: Für mein Grundszenario betragen die Stromkosten 4,65 Cent pro Kilowattstunde. Bei heutiger Technologie.
Aber die Gesamtinvestitionen sind immens. Ungefähr das Vierfache der von der Münchner Rück angesetzten Summe, aber für 100 Prozent erneuerbare Energie für das gesamte Szenario mit 67 Ländern.
Deutsche Stromkonzerne zeigen bislang wenig Interesse an regenerativer Energie und setzen vermehrt auf andere Technik. Stichwort: "saubere Kohle". Das Warten auf die sogennante CCS-Technik ist eine verheerende Idee. Mit diesem Verfahren soll Kohlendioxid aus Abgasen abgeschieden und anschließend deponiert werden, sodass es nicht in die Atmosphäre gelangt. Doch im großen Maßstab ist dies - nach Aussagen der Stromversorger - frühestens 2020 machbar. Bis dahin bestehen Pläne, in Europa große Kohlekraftwerke mit weit über 50 Gigawatt Leistung zu bauen, die diese Technik nicht haben und dann noch 40 Jahre lang laufen würden. Warum diesen Weg gehen, wenn erneuerbare Energien billiger wären? Immerhin erkennen die Stromversorger die Option Stromimport aus Afrika mittlerweile an. Aber eine klare Äußerung, dass man diese Lösung schnell umsetzen möchte, gibt es nicht.
Trotz Ihrer Vorarbeiten: Bei der Vorstellung des Desertec-Projekts wurden Sie nicht einmal eingeladen. Fühlen Sie sich ausgebootet? Ich hatte die Münchener Rück 2005 angesprochen, Anfang 2006 meine Ergebnisse dorthin geschickt und für eine großräumige Stromversorgung mit erneuerbaren Energien geworben. Die Leiterin des Umweltmanagements hat damals geantwortet, dass so eine Initiative nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens gehöre. Das Schreiben endete mit dem Wunsch, dass ich mit meinem Ansatz "weiterhin Aufmerksamkeit erhalten und Umsetzungspfade eröffnen" möge. Ausgebootet ist ein scharfes Wort. Sagen wir: Ich wundere mich schon.