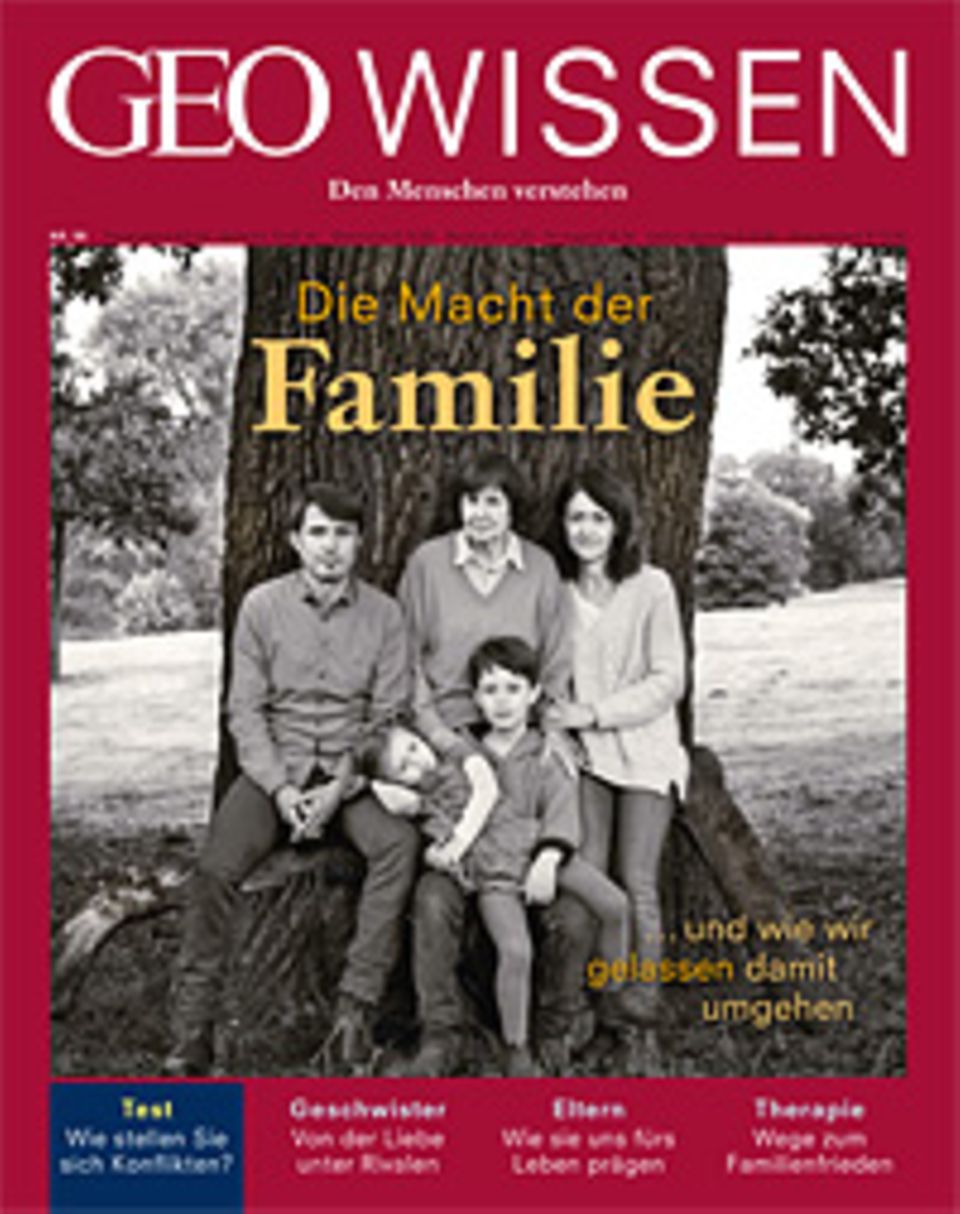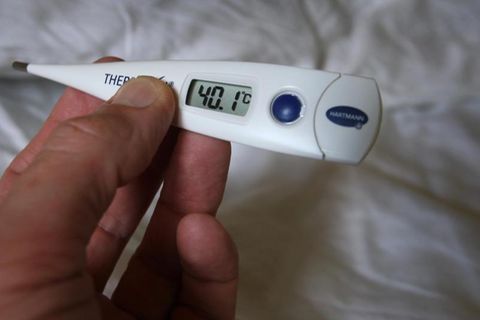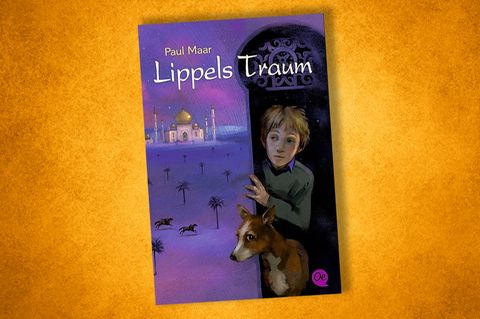GEO WISSEN: Frau Dr. Konrad, in manchen Familien öffnen sich menschliche Abgründe, es gibt Geschichten von Hass, Hinterlist und Heimlichkeit. Gibt es in jeder Sippe „dunkle“ Geheimnisse?
DR. SANDRA KONRAD: Mit Sicherheit hat jede Familie Geheimnisse, aber die müssen keineswegs alle dunkel sein. Sie können auch positive und geradezu lebensnotwendige Funktionen haben. Etwa für unsere Privat- und Intimsphäre, für Bereiche also, die nur uns gehören und von anderen respektiert werden sollten. Dazu zählen beispielsweise „süße Geheimnisse“, wenn ein Paar schwanger wird, aber dies der Verwandtschaft noch nicht verrät. Auch für Kinder und Jugendliche sind Geheimnisse äußerst wichtig, etwa wenn sie ein Tagebuch führen, sich verlieben, die ersten sexuellen Erfahrungen machen. Oder wenn Geschwister sich gegenseitig decken, weil der eine mal zu spät oder betrunken nach Hause kommt. Dadurch haben sie die Möglichkeit, sich abzugrenzen, Autonomie und auch Individualität zu entwickeln.

Was zeichnet dann demgegenüber ein „dunkles“ Geheimnis aus?
Dass es Leid mit sich bringt. Denn solche Geheimnisse entwickeln sich aus Angst, Scham, Schuldgefühlen oder auch unverarbeiteter Trauer. Wir halten vor allem dann etwas geheim, wenn gegen eine Norm verstoßen wird: wenn es zu Gewalt in der Ehe kommt, zum Missbrauch eines Kindes, der Partner betrogen wird oder jemand in der Familie psychisch krank ist. Da Normen und Werte aber einem steten gesellschaftlichen Wandel unterliegen, kann sich der Inhalt von Geheimnissen im Laufe der Zeit durchaus verändern: Homosexualität, die lange als Verbrechen oder Krankheit galt, muss heute niemand mehr geheim halten.
Manche Geheimnisse werden in Familien sogar viele Jahrzehnte bewahrt. Wieso schweigen Angehörige so lange über etwas, wenn dieses Schweigen doch Leid bringt?
Wenn beispielsweise Kinder spüren, dass es Themen gibt, an die besser nicht gerührt wird, stellen sie oft auch keine Fragen. Weil sie das, was die Eltern vorleben und vorschreiben, erst einmal für normal halten und nicht in Zweifel ziehen. Außerdem bringt uns als Kind, aber auch noch als Erwachsener, die Loyalität – also dieses besondere Treuebündnis aus Liebe, Dankbarkeit und Gehorsam – dazu, dass wir uns oft sehr lang an die „Gesetze“ unserer Familie halten. Selbst wenn wir ahnen, dass sie nicht richtig sein können. Es ist für einen Menschen eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben, sich langsam und bewusst aus der Abhängigkeit und einer zu starken Loyalität zu lösen, um so wirklich erwachsen zu werden. Aber nicht jede Familie ist mit dieser Ablösung einverstanden, weil jede individuelle Entwicklung die Regeln der Sippe und somit ihren Zusammenhalt zu bedrohen scheint.
Das klingt, als wäre eine Familie so etwas wie eine Sekte: Wer einmal darin ist, kommt nur schwer wieder los.
Ja und nein. Jede Familie verlangt ein gewisses Maß an Loyalität, und aus Liebe und Dankbarkeit sind Kinder oft dazu bereit. Es gibt allerdings Familien, in denen Loyalität über die Maßen eingefordert wird und in denen jede Form der Ablösung oder Kritik als Frevel gilt. Wer aus solchen Familien „auszubrechen“ versucht, hat es sehr schwer und gilt oft als Nestbeschmutzer.
Das ist vermutlich auch ein Grund, weshalb Missbrauchstäter meist in der Familie zu finden sind: Sie nutzen die Loyalität des Kindes aus.
Sie nutzen zunächst einmal die Unterlegenheit des Kindes aus und überschreiten alle Grenzen. Es gibt Täter, die vor allem einschüchtern und erpressen, und andere, die an die Loyalität des Kindes appellieren. Weil der Täter zudem mitunter der einzige Mensch ist, der liebevoll zu dem Kind ist und ihm Aufmerksamkeit schenkt, gerät es in eine schreckliche Lage – eine Kombination aus Abhängigkeit, Angst und Schweigen. Das macht es für Außenstehende mitunter so schwer, diese Verbrechen aufzudecken. Es ist allerdings ein Unterschied, ob ein Geheimnis eine Familie auch im Inneren spaltet oder gegenüber der Außenwelt besteht. Bei Missbrauch kann beides der Fall sein.
Worin genau liegt der Unterschied?
Bei einem Geheimnis nach außen hin sind alle Familienmitglieder Mitwisser und gemeinsam an der Vertuschung beteiligt. Zum Beispiel, wenn der Vater trinkt und seine Arbeit verliert, oder wenn die Mutter in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wird. Die ganze Familie unternimmt dann erhebliche Anstrengungen, damit draußen niemand etwas davon erfährt. Heimlichkeiten innerhalb der Familie dagegen können einen starken Loyalitätskonflikt zwischen den Angehörigen erzeugen. Etwa, wenn der Sohn mitbekommt, dass der Vater eine Geliebte hat, und das vor der Mutter geheim hält. Ein solches Geheimnis zu hüten ist sehr belastend. Aber auch Geheimnisse unserer Vorfahren hinterlassen ihre Spuren. Zum Beispiel schreckliche Ereignisse aus der Vergangenheit, über die in der Familie niemals geredet wird.
Wie kann ein Vorfall, von dem das Kind nichts weiß, sein Leben belasten?
Das lässt sich am besten an einem Beispiel erläutern: Vor einiger Zeit kam ein Mann in meine Praxis, der eine unbändige Wut in sich spürte. Er nannte sich selbst ein wandelndes Pulverfass, konnte sich das aber nicht erklären. Also beschloss ich, mir gemeinsam mit ihm seine Familiengeschichte näher anzuschauen. In der Systemischen Therapie gibt es hierfür eine bewährte Technik: das Genogramm.
Was ist das?
Eine Art psychologischer Stammbaum, den ich mit meinen Klienten aufzeichne. Neben jedem Familienangehörigen tragen wir dessen besondere Merkmale ein und notieren, in welchem Verhältnis er zu dem Klienten steht. Das allein kann schon sehr aufschlussreich sein. Mindestens genauso interessant sind aber die weißen Flecken auf der Familienlandkarte, das, worüber der Klient nichts weiß oder vielleicht nichts wissen sollte und durfte – dort liegt oft ein Geheimnis begraben, und so war es auch in diesem Fall.
Die Familie hatte etwas zu verbergen?
Ja, es gab ein Geheimnis um den verstorbenen Großvater, über den mein Klient praktisch nichts wusste. Als er seine Angehörigen nach ihm fragte, reagierten sie abwehrend. Doch er blieb hartnäckig und erfuhr schließlich den Grund für die Verschlossenheit: Der Großvater war ein extrem gewalttätiger Mann, der einen bestialischen Mord begangen hatte, für den er Jahrzehnte lang im Gefängnis saß. Nach seinem Ableben beschloss die Familie, diese Person – und ihre Tat – totzuschweigen.
Es ist aber kaum vorstellbar, dass Ihr Klient die Brutalität gewissermaßen von seinem Großvater geerbt hat.
Das emotionale Erbe unserer Vorfahren übermittelt sich auf verschiedenen Wegen: über die Gene, über das Verhalten, über Bindungserfahrungen, über das, was erzählt, und sogar das, was verschwiegen wird. Selbst wenn wir eine genetische Anlage erben, müssen weitere auslösende Faktoren hinzukommen, damit sich diese auch entfaltet. Bei meinem Klienten war das Verhalten der Familie entscheidend: Alle hatten Angst, dass er genau so werden könnte wie sein Großvater, also taten sie alles dafür, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.
Wie läuft so etwas ab?
Als kleiner Junge, so erinnerte mein Klient sich, durfte er nie ungehalten sein, sonst wurde er ausgeschimpft, bei jedem Anzeichen von Wut zuckten die Angehörigen zusammen. So lernte er, seinen Ärger zu unterdrücken – nicht aber, wie man Aggressionen reguliert. Von einem bestimmten Punkt in seinem Leben an war er dann nicht mehr in der Lage, mit Stress umzugehen, etwa im Beruf oder in der Familie.
Kann die Erkenntnis dieses Zusammenhangs allein schon heilsam sein?
Es ist ein erster wichtiger Schritt. Mein Klient war zunächst einmal sehr erleichtert, eine Erklärung für seine Aggressionen gefunden zu haben. „Das ist nicht meine Wut, sondern die meines Großvaters“, sagte er immer wieder. Aber nach dem Erkennen und Verstehen muss das Fühlen folgen: Wo wurde er unterdrückt, wo ging seine nicht erlaubte Wut hin, wie möchte er heute als erwachsener Mann mit seinen Gefühlen umgehen?
Offenbar geht es bei Geheimnissen immer um Aufwühlendes, das aber nicht offen ausgesprochen wird. Das erinnert stark an Traumata. Besteht da ein Zusammenhang?
Ein traumatisierter Mensch hat eine furchtbare Erfahrung noch nicht verarbeitet. Es fällt ihm schwer, Worte für das Geschehene zu finden. Schweigen ist also die Gemeinsamkeit zwischen einem Trauma und einem Geheimnis. Traumatisierte schweigen oft, um sich selbst oder ihre Umgebung zu schützen. Und weil sie der traumatischen Erfahrung hilflos ausgesetzt waren, vermeiden sie es so gut es geht, daran erinnert zu werden, während sie gleichzeitig von sogenannten „Flashbacks“ – Erinnerungsblitzen – heimgesucht werden. Je mehr sie innerlich vereisen, desto intensiver wirkt jedoch das Trauma. Das hat Folgen, auch für spätere Generationen.
Inwiefern sind die Nachkommen davon betroffen?
Jede psychische Erfahrung, die nicht verarbeitet werden konnte, wird sich im Leben der nächsten Generation widerspiegeln. Das können Kriegserlebnisse sein, Flucht und Migration, Verbrechen, Gewalt, schwere Ungerechtigkeiten, Schuld und Scham. Die Forschung zeigt: Schwer Traumatisierte wie beispielsweise Holocaust-Überlebende hatten oft Schwierigkeiten, sich emotional fallenzulassen, sich auf andere einzulassen. Weil sie ihre eigenen Gefühle einfrieren mussten, um zu überleben, wuchsen auch ihre Kinder häufig in einer tabuisierten, gefühlsarmen Atmosphäre auf. Gleichzeitig spürten die Kinder die abgespaltenen Gefühle der Eltern und übernahmen sie. Statt mit Urvertrauen, Geborgenheit und Sicherheit wuchsen sie mit dem Gefühl auf, dass die Welt ein unsicherer Ort ist. Traumatische Erfahrungen der Eltern sind für Kinder hochansteckend. Die Ängste der Eltern schleichen sich gewissermaßen in die Gefühlswelt der Kinder ein – Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von „transgenerationaler Weitergabe“ oder „Übertragung“.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ich habe vor einigen Jahren im Rahmen meiner Doktorarbeit die Töchter und Enkeltöchter von Holocaust-Überlebenden interviewt. In beiden Generationen gab es Anzeichen posttraumatischer Belastungsstörungen. Viele hatten die Ängste der Eltern oder Großeltern übernommen. So erzählte mir eine Tochter, dass sie Panikattacken bekommt, wenn sie Sirenen hört oder Uniformen sieht. Eine Enkelin berichtete, dass sie als Kind Angst hatte zu duschen, eine andere konnte sich nicht in einer Warteschlange für Essen anstellen. Viele leben bis heute mit dem Gefühl, „auf gepackten Koffern zu sitzen“, und machen Pläne, wie sie im Notfall an einen neuen Pass kommen und flüchten könnten. Und wohlgemerkt: All diese Menschen haben die Verfolgung und das Leid in den Konzentrationslagern nicht selbst erlebt. Es sind die Erfahrungen ihrer Eltern und Großeltern, die sich in ihren Gefühlen – in ihren Existenz- und Verlustängsten – widerspiegeln.
Wie konnten sich derart konkrete Ängste entwickeln, obwohl die traumatisierten Eltern oder Großeltern kaum über ihre Erlebnisse und Gefühle gesprochen haben?
Auch wenn die Familien nicht offenbarten, was im Detail geschehen war, hatten die Kinder sehr feine Antennen für die Gefühle ihrer Eltern, auch für jene Emotionen, welche die Erwachsenen zu unterdrücken versuchten. Die Kinder ahnten und sie spürten: Es ist etwas Schreckliches in der Familiengeschichte verborgen. Gleichzeitig gab es das unausgesprochene Gebot des Schweigens, um die Eltern zu schonen. Die meisten hatten dennoch hier und da etwas aufgeschnappt, bei jüdischen Freunden vielleicht oder in der Schule. Sie wussten, was im „Dritten Reich“ mit den Juden geschehen ist und dass ihre eigene Familie irgendwie betroffen war. Sie hatten grobe Sachinformationen, die sie mit ihren Fantasien anreicherten. Oft kamen diese Vorstellungen der Realität erstaunlich nahe. Das Schlimme war, dass nun auch die Kinder mit ihren Gefühlen allein blieben, weil es für die Beteiligten nicht möglich war, miteinander darüber zu sprechen: Die Traumatisierten schwiegen ja, um sich und ihre Nachkommen zu schonen und sie nicht zu belasten.
Das ganze Interview lesen Sie in GEO WISSEN "Die Macht der Familie".