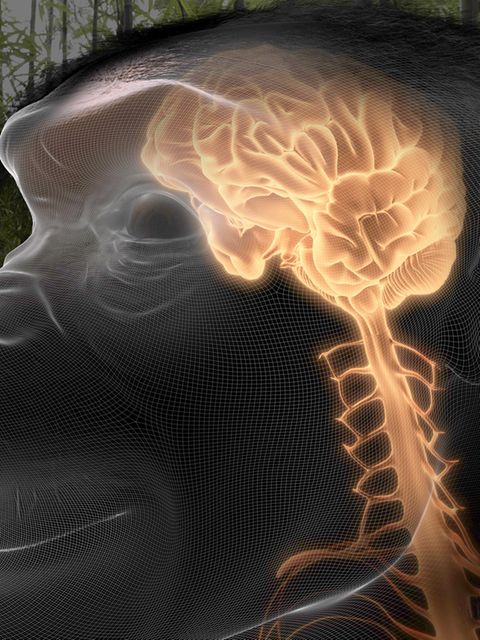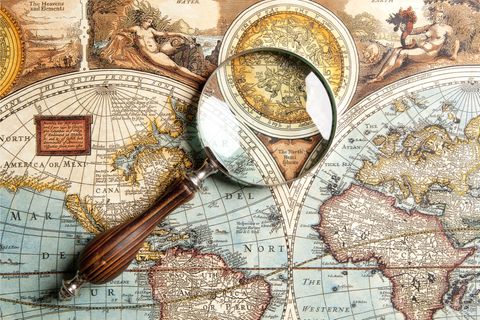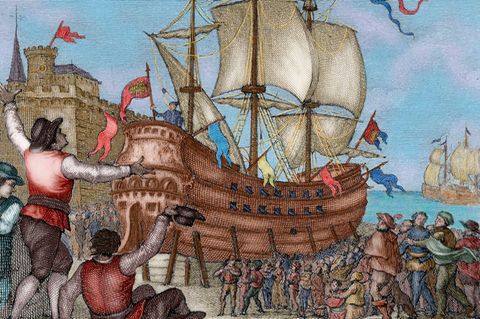Meine Reise beginnt dort, wo sie für viele andere endet – mitten in einer Schafherde auf einem Deich westlich von Emden. In Ostfriesland. Auf der einen Seite rauscht das Meer, das Sehnsuchtsziel der meisten Urlauber. Ich aber schaue Richtung Inland, wo in der Mittagssonne auf einem Hügel das Warftendorf Rysum schlummert. Rysum, rund 850 Einwohner, ist die erste Station auf meiner Reise durch das Hinterland der Nordseeküste.
Ich werde auf dieser 300-Kilometer- Autotour von Emden nach Glückstadt viel sehen, nur eben nicht das Meer. Ich werde fröstelnd durch ein Moor laufen, in einem Bunker meinen Urängsten begegnen, die heimeligsten Häuser Deutschlands sehen und mich wie der Papst auf seiner Terrasse fühlen. Die Schafe ziehen mähend langsam weiter, und auch ich breche auf.
Tag 1: Emden und Umgebung

Das Runddorf Rysum, 15 Kilometer westlich von Emden, hat passenderweise eine Ringstraße, die einmal um den Dorfkern mit seiner prächtigen Backsteinkirche führt. Während ich in 20 Minuten einmal im Kreis flaniere, kommen mir gerade einmal zwei Autos entgegen.
Jedes einzelne rote Backsteinhaus am Straßenrand ist ein Zeugnis hingebungsvoller Sorgfalt: An den Türen hängen golden schimmernde Türklopfer, die Namensschilder sind handgemalt und mit kleinen Bildern meist von Schiffen verziert, in den Vorgärten sauber geschnittener Rasen, umringt von bunten Blumen, auf einer Bank fein angeordnet ein Dutzend Tonfiguren, die mich anlächeln.
Wozu das alles? Ein jüngerer Mann, der in seinem Garten arbeitet, sieht mich freundlich an, er hält die Frage für falsch. "Wir wollen es eben sehr gemütlich haben, da achten wir auf alles ein bisschen mehr", sagt er. Im Gespräch mit ihm und anderen Ostfriesen wird mir schnell klar: Wenn man hinter einem Hunderte Kilometer langen Deich lebt, vermittelt das nicht nur eine gewisse Sicherheit, sondern auch ein Gefühl der Geborgenheit. Und das wird hier wahrhaftig gehegt und gepflegt.
Beglückt fahre ich in einer Viertelstunde nach Emden. Im Süden der Stadt erstreckt sich unmittelbar neben dem Deich das "Ökowerk", wo ich ein weiteres Kennzeichen ostfriesischer Lebensart kennenlerne. Esther Saathoff, die durch ihre dunkle Brille eher idealistisch in die Welt blickt, führt mich durch das Herzstück des Geländes: das "Pomarium Frisiae", eine Plantage, auf der rund 600 verschiedene Apfelsorten wachsen.
Dass hier laut Esther Saathoff "eine wohl einmalige Vielfalt" versammelt ist, lässt die Äpfel bei der anschließenden Probierrunde noch besser schmecken. Ich füge zur Geborgenheit noch Naturverbundenheit hinzu. Daseinssorgfalt – vielleicht lässt sich so die ostfriesische Lebensweise am besten beschreiben. Emden selbst ist mit gut 50 000 Einwohnern die größte Stadt Ostfrieslands, geprägt von der Ems und einem Geflecht kleiner Kanäle.
Im idyllischen Ortskern, der sich ums Hafenbecken legt, vergeht der Abend im Nu. Ich besuche das Otto Huus – eine Art Museum für den berühmten Komiker Otto Waalkes, der von hier stammt und manchmal selbst an der Kasse sitzt, hier findet sich von Ottifanten-Plüschtieren bis zum Kinosaal mit Otto-Filmen in Dauerschleife alles, was der Künstler hervorgebracht hat. Danach geht es für ein Dinner auf dem Museums-Feuerschiff "Amrumbank", das im Hafen vertäut ist. Unter Deck wird Granat serviert, Nordseekrabben. Das Meer vermisse ich nicht.
Tag 2: Greetsiel und Großes Meer

Eine halbe Stunde dauert die Fahrt von Emden aus, dann liegt das Fischerdorf Greetsiel vor mir: Für Ostfriesland ein Besuchermagnet ersten Ranges. Schon am Ortseingang: überall Touristen auf der Straße. Im Schritttempo rolle ich mit meinem Auto an den beiden Zwillingswindmühlen vorbei, neben dem Kutterhafen ein Wahrzeichen von Greetsiel. Kurz darauf muss ich zu Fuß weitergehen, der Ortskern ist komplett autofrei. Ein heimeliges Giebelhäuschen schmiegt sich an das nächste. Die langen Dächer, die fast bis auf den Boden reichen, und der rote Backstein lassen bis ins 17., 18. Jahrhundert zurückblicken. Die Stadt ist eine Art Freilichtmuseum, ohne dabei ihre Authentizität zu verlieren.
Ich leihe mir ein Ruderboot und erlebe Greetsiel vom Wasser aus. Gute Entscheidung, denn ausgerechnet in den engen Kanälen entfaltet sich der befreiende Eindruck von Weite: Die Wasserläufe von Greetsiel sind an das Hunderte von Kilometer lange Kanalnetz von Ostfriesland angeschlossen. Wenn ich einen ganzen Tag Zeit hätte, könnte ich bis nach Pilsum rudern.
Von Greetsiel bis zum nächsten Ziel bin ich mit dem Auto eine knappe halbe Stunde unterwegs. Wie überall in Ostfriesland sieht die Landschaft meist so aus: Schafe, Kühe, noch ein paar Schafe, eine Windmühle, Schafe, ein Kanal, ein Dorf mit gepflegten roten Backsteinhäusern, die einem sorgfältig gezeichneten Bilderbuch entsprungen zu sein scheinen, dann wieder Kühe. Der Frieden dieser Region, die Beschaulichkeit – schon nach zwei Tagen strahlt alles unweigerlich auf mich ab. Ich komme zur Ruhe, obwohl ich unterwegs bin. Und bleibe gelassen, auch als mein Navigationssystem versagt.
Eine Frau am Straßenrand wird weiterhelfen können, sie führt offenbar ihr Pony spazieren. Die beiden blicken mich geduldig an, als ich nach dem Großen Meer frage. Während das Pony seinen Kopf in das laue Lüftchen dreht, erklärt mir die Frau in aller Ruhe und Ausführlichkeit, wie ich weiterfahren soll. Ein paar Mal links und rechts, über eine schmale Brücke, dann sei ich schon am Ziel.
Fünf Minuten später erstreckt sich vor mir das Nordende des Grossen Meers, das gar keines ist, sondern ein riesiger See. Den kleinen Sandstrand hier nutzt allerdings kaum jemand. Denn am Großen Meer dreht sich alles um Sport, bei den Verleihern gibt es Hydrobikes – eine Art Fahrrad auf Schwimmrümpfen mit Schaufelantrieb –, alle Arten von Booten, Windsurfausrüstung. Ich aber entscheide mich für eine Fahrradtour auf dem Drei-Meere-Weg, der einmal um den See und benachbarte Gewässer führt. Auf einem Mountainbike fliege ich zwischen gelb blühenden Wiesen und dem See dahin.
Fahrradfahrer und Wanderer lächeln mir zu. Wir sind uns ohne Worte einig, hier ein kleines Paradies entdeckt zu haben. Eines, in dem man auch arbeiten muss: An zwei Wasserläufen besteige ich mit anderen eine kleine Fähre, »Pünte« genannt. Es gibt keinen Fährmann, wir müssen uns mit einem Schwungrad an einem Drahtseil selbst ans andere Ufer kurbeln.
Tag 3: Moordorf, Wiesmoor und Jever
Vom Grossen Meer geht es weiter ins Binnenland. Nach einer Viertelstunde parke ich vor dem Moormuseum in Moordorf. Es zeigt 200 Jahre im Leben der ersten Kolonisten, ein Leben in bitterster Armut, in kümmerlichen Lehmkaten, auf kargem Grund. Neben dem Freilichtmuseum erstreckt sich ein Stück echtes Moor, ich durchquere es und denke leicht fröstelnd an Geschichten von Moorleichen.
Ostfriesland war lange zu einem großen Teil Feuchtgebiet, die Kolonisierung im 18. Jahrhundert ein Kampf, geführt von mittellosen, ungebildeten Siedlern ohne jede Perspektive. Eine Redensart aus der Gegend besagt:
"Die Ersten sehen den Tod,
die Zweiten sehen die Not,
die Dritten sehen das Brot."
Um wieder in Stimmung zu kommen, besuche ich eine Teestube in Moordorf. Den Tee trinke ich, ganz nach ostfriesischer Tradition, mit dem obligatorischen Stück Kandiszucker und
ohne umzurühren, versteht sich. "Und wenn doch umrühren, dann gegen den Uhrzeigersinn, damit die Zeit stehen bleibt", flüstert mir eine dunkelblonde Frau an der Theke mit einem
wissenden Lächeln zu.
Aber ich will weiter. Ein Abstecher nach Süden, nach Wiesmoor, zu einem Mann, der noch wie früher Torf abbaut. Eine ältere Frau öffnet die Haustür und nickt zur Begrüßung: "Kommen sie rein, Johann ist schon beim Torf.« Der Garten hinter dem Haus ist eher ein kleines Feld. Eines mit bestimmt 100 Türmchen aus Torfstücken, jedes so groß wie ein Ziegelstein.
Johann Behrends, 76, wettergegerbtes Gesicht, ist zufrieden: "Es sieht gut aus, wollen wir hoffen, dass es morgen nicht regnet." Eine hohe Kante am Ende des Feldes zeugt von seiner Arbeit im 8000 Jahre alten Hochmoor, in dem sich abgestorbene Pflanzenreste zu Torf wandeln. Jedes Jahr trägt Behrends etwas davon ab und stapelt die Stücke, damit sie schnell trocknen.
Anschließend verkauft er den Torf als Brennstoff an Privatleute aus der Region, die damit ihren Ofen beheizen. Ob sich das Ganze finanziell lohnt, ist fraglich. "Es wurde seit jeher so gemacht, und es ist die beste Art, den Torf zu nutzen. Das reicht für mich schon als Grund", sagt Behrends und rückt ein Türmchen zurecht. Da ist sie wieder, die Daseinssorgfalt.
Eine halbe Stunde später erreiche ich meine letzte Station in Ostfriesland, Jever. Das gleichnamige Bier ist ein internationaler Bestseller, doch die Brauerei lasse ich links liegen. Stattdessen besuche ich einen traditionellen Handwerker: Georg Stark, weißes Haar, weißer Bart, leuchtende Augen wie ein 20-Jähriger. Er betreibt eine Blaudruckerei, in der er mit Indigo Textilien einfärbt und mit klassischen Mustern verziert.
Dort, wo zuvor eine wachsartige Schutzschicht aufgetragen wurde, bleibt der Stoff weiß, alles andere wird blau. "Ich führe nur fort, was die Inder vor Jahrhunderten in Ostfriesland eingeführt haben", sagt Stark. Inder in Ostfriesland? Die Nähe zur Nordsee war für die Ostfriesen ein Tor zur Welt – und für die Welt ein Zugang zu Ostfriesland. Das Geschäft von Georg Stark, gefüllt mit Textilien vom Taschentuch bis zum Ballkleid, ist auch seine Werkstatt.
Man kann auch eigene Stoffe mitbringen, die hier "ihr blaues Wunder erleben", wie Stark es ausdrückt. Ich habe nichts Passendes dabei. Ein Grund, wiederzukommen. Und bevor ich dieses sympathische Ostfriesland hinter mir lasse, trinke ich abends doch noch ein Jever.
Tag 4: Wilhelmshaven
Wilhelmshaven, am Jadebusen, ist meine nächste Station. Vom Boden der Fußgängerzone springen mir bunte Kreidefiguren entgegen, ein paar Schritte weiter drohe ich in gähnende Trompe-l’oeil-Löcher zu fallen: Das jährliche "StreetArt Festival" macht das Zentrum zu einer Kunstmeile. Abgesehen davon ist Wilhelmshaven nicht unbedingt ein Schmuckstück. Im Zweiten Weltkrieg war die Stadt eine der am heftigsten bombardierten deutschen Metropolen, nicht zuletzt wegen der Nähe zur Nordsee und damit zu Großbritannien. Die Bevölkerung suchte Schutz in mehr als 200 Bunkern.
"Gehen wir rein", sagt Holger Hiebner, der mit seiner getönten Brille und dem schwarzen T-Shirt aussieht wie jemand, der viel Zeit an seinem Computer verbringt. Aber das hier ist die Realität: Als die Tür hinter uns zufällt und wir die Treppe des Luftschutzbunkers hinaufsteigen, fühle ich mich bereits unwohl. Ein paar Wandlampen spenden spärliches Licht, und vor mir funzelt Hiebners Taschenlampe.
Etwa 1500 Menschen haben in diesem Bunker während des Zweiten Weltkrieges Schutz gesucht, bei jedem Fliegeralarm, und manchmal mehrmals pro Nacht. Der rundliche, betongraue Turm ist einer der letzten erhaltenen Bunker in Deutschland, Holger Hiebner betreibt ihn als Bunkermuseum gemeinsam mit vier weiteren Ehrenamtlichen.
"Ruhe bewahren", mahnen altdeutsche Lettern an der Wand, in der Mitte jeder Etage steht ein Kabuff mit Toilette. Hiebner zeigt mir die Atemmasken, die Luftversorgung, die Propagandablättchen, alles Originale. Ich gebe mir Mühe, aber meine leicht klaustrophobische Veranlagung lässt meine Nervosität wachsen. Ich bin froh, als ich wieder Sonnenlicht sehe.
In Wischhafen an der Elbe und auf der Fähre Richtung Glückstadt pustet der Wind meinen Kopf wieder frei. Glückstadt ist das Ziel meiner Reise – das 11 000-Einwohner-Örtchen mit der Fortuna im Wappen, das im Jahr 2017 sein 400-jähriges Jubiläum feiert.
Tag 5: Glückstadt

Als ich am nächsten Morgen im Hotel »Der Däne« aus dem Fenster schaue, fühle ich mich ein bisschen so, wie sich wahrscheinlich der Papst auf seinem Balkon im Vatikan fühlt: Ich überblicke den Marktplatz von Glückstadt, auf den alle sieben Straßen zulaufen. Glücklich in Glückstadt – ich hole mir einen Stuhl und sehe zu, wie der Ort langsam erwacht.
Der Platz wird gesäumt von Häusern aus dem Frühbarock, Zeugen einstiger Wirtschaftsblüte und bis heute einzigartig in ihrer Pracht und Geschlossenheit. Ein paar Straßen weiter, denke ich, kommt der Deich, dann die Elbe, die in ein paar Kilometern in die Nordsee mündet. Eine Woche hat die Reise gedauert, und sie hat – ganz ohne Meer – meinen Horizont erweitert.
Tipps entlang der Route sowie weitere Inspirationen zur Nordsee lesen Sie im neuen GEO SPECIAL!