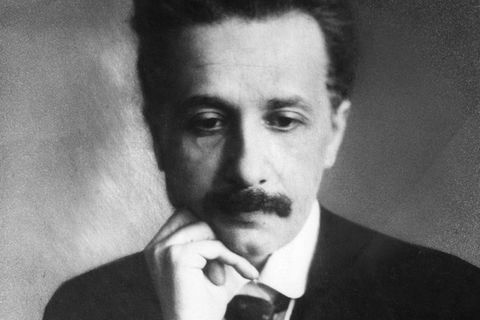Du bist Teil einer besonderen Expedition gewesen, die Erkenntnisse für die Intensivmedizin gewinnen wollte. Aber, was hat Bergsteigen mit Intensivmedizin zu tun?
Die Idee dieser Expedition war, dass Intensivmediziner auf einem hohen Berg im Himalaya erforschen wollten, wie sich Sauerstoffmangel auf den menschlichen Körper auswirkt. Auf der Intensivstation haben Patienten oft unter Sauerstoffmangel zu leiden. Allerdings kann man an Intensivpatienten nur sehr schwer forschen, weil sie viel zu labil sind und außerdem so viele verschiedene Leiden haben, dass man nicht so genau herunterbrechen kann, welche Rolle der Sauerstoff dabei spielt. Und um das genauer herauszufinden, haben sich diese Ärzte überlegt, dass sie 40 Probanden auf einen hohen Berg begleiten und dort dann ganz konkret erforschen, was die Auswirkungen des Sauerstoffmangels sind.
Was sind das für Leute, die sich solchen Bedingungen aussetzen?
Die Probanden waren zwischen 26 und 70 Jahre alt. Das sind normale Bergsteiger, wobei normal auch bedeutet, dass alle schon häufiger im Gebirge waren, aber nicht unbedingt auf so großen Höhen. Für die war das natürlich auch interessant. Zum einen, um auf so einem hohen Berg unter medizinischer Beobachtung - also in einer gewissen Sicherheit -unterwegs zu sein. Zum anderen war ihnen auch wichtig, dass Ihre Leidenschaft für die Berge auch mal anderen Menschen zugute kommt.
Mussten die Probanden spezielle medizinische Voraussetzungen haben, gab es Tests?
Es gab eine ganze Reihe von Untersuchungen während der Expedition. Vorher wurde natürlich getestet, ob die Bergsteiger für die Expedition geeignet sind. Bewerber mit chronischem Herzleiden, konnten nicht mitreisen.
Wie hast Du Dich denn selbst vorbereitet?
Ich war selbst schon häufiger im Gebirge, allerdings noch nie auf so großen Höhen. Ich war einmal in den Anden auf 5600 Metern und wusste daher, dass ich in der Höhe noch ganz gut klar komme. Aber man kann es natürlich nie genau sagen, wie man reagiert. Sich in Hamburg auf eine Hochgebirgsexpedition vorzubereiten, ist natürlich etwas schwierig. Ich habe viel Ausdauertraining gemacht. Das hatten mir die Ärzte empfohlen. Ich bin also viele Male um die Alster gelaufen, bin an der Elbe Treppen hoch und runtergelaufen und habe im Sommer im Gebirge noch ein paar Höhenmeter trainiert und mich an die Ausrüstung gewöhnt.
Ist man denn nicht als Reporter wahnsinnig mit sich selber beschäftigt, wenn man da hochsteigt? Wie schafft man es da überhaupt noch, einen Blick für die anderen zu haben?
Das ist die Herausforderung. Man muss natürlich immer an die Geschichte denken und sich überlegen, was man eigentlich erzählen möchte. Gleichzeitig darf man auch nicht unnötige Risiken eingehen und sich selbst in zu große Gefahr bringen. Es gibt objektive Gefahren in den Bergen: Lawinen, die Höhe. Für uns Reporter kommt dann immer noch dazu, dass wir die Geschichte mitdenken müssen. Da macht man sich schon häufiger Gedanken und befragt sich selbst, ob man noch in der Lage ist, weiterzugehen.
Wie macht sich denn die Höhenkrankheit überhaupt bemerkbar?
Die Höhenkrankheit ist ein Sammelbegriff für verschiedene Symptome, die im Körper entstehen durch den Sauerstoffmangel der Gebirgsluft . Die ersten Auswirkungen der so genannten akuten Bergkrankheit, das kann so ab 2500 Metern einsetzen, sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Wenn man dann nicht absteigt, dann kann sich das immer weiter verschlimmern. Dann kann es zu Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge und im Gehirn kommen (Hirn- oder Lungenödem). Das kommt dadurch, dass der Blutdruck steigt. Der Körper versucht, den wenigen Sauerstoff auszugleichen und dann können Gefäße platzen oder sich ausstülpen. Die Ventile in den Zellen können geschädigt werden und das kann wirklich bis zum Tod führen. Auch auf der Expedition hatten wir mehrere Personen, die ausgeflogen werden mussten.
Hast du selber irgendwelche Anzeichen an Dir bemerkt?
Ich hatte Kopfschmerzen, allerdings weniger, als ich gedacht hätte. Meine eigene Langsamkeit hat mich allerdings viel mehr beschäftigt. Je höher man steigt, desto langsamer bewegt man sich vorwärts. Dafür braucht man viel Geduld. Auf 7000 Metern hat mich dann die Kälte wirklich mitgenommen. Ich hatte kaum noch Appetit und starke Kopfschmerzen. Die Probanden mussten sich während der Expedition verschiedenen Tests unterziehen.
Was gehörte dazu?
Es wurden vor allem Blutuntersuchungen vorgenommen, aber auch Ultraschalluntersuchungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Lunge und des Gehirns. Und auf einem Fahrradergometer wurde ein Belastungstest durchgeführt und die Atmung kontrolliert. Nach dem Aufstieg mussten die Probanden also noch bis zur Erschöpfung auf dem Fahrrad treten. Ich habe das selbst ausprobiert und musste irgendwann aufgeben.
Wie viele der Teilnehmer haben den Gipfel erreicht?
Von den knapp 40 Probanden, haben es 15 bis nach oben geschafft – also bis ins letzte Camp.
Würdest du selbst an so einer Expedition nochmal teilnehmen?
Man soll ja niemals nie sagen, aber ich fand schon, dass die objektiven Gefahren in diesem Hochgebirge schon groß sind. Es kann jederzeit das Wetter drehen. Und selbst wenn man denkt, man hat alles unter Kontrolle, kann es sehr schnell kippen durch ein bisschen Wind oder eine Lawine, aber unterm Strich war es eine tolle Erfahrung. Die Ärzte und Forscher haben uns wahnsinnig gut eingebunden und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir das mitmachen konnten.
Ausführliche