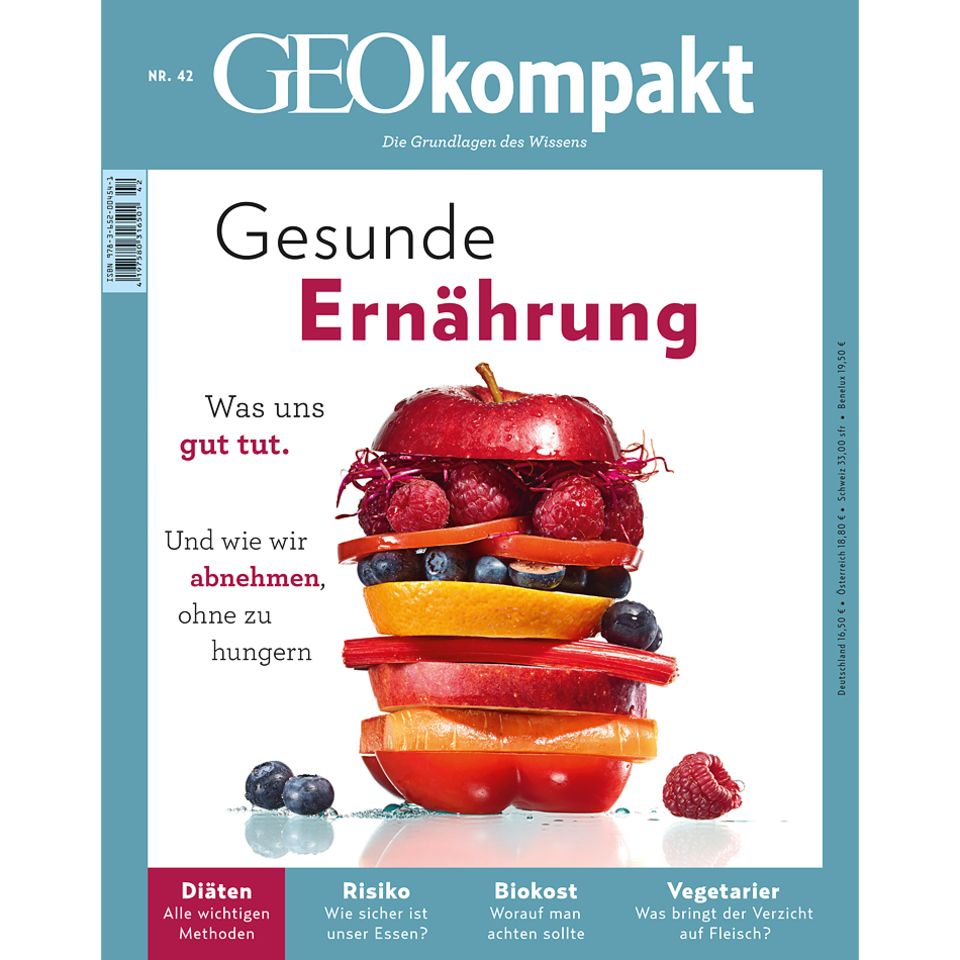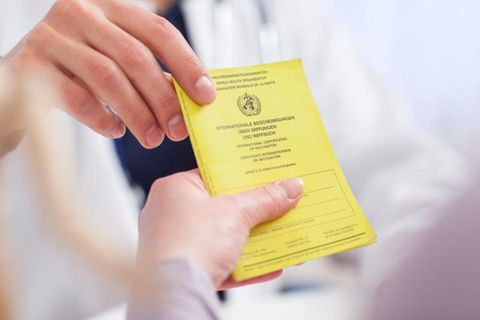Die Häftlinge, die im Aylesbury-Gefängnis nordwestlich von London einsitzen, sind jung und gewaltbereit. Rund 40 Prozent der 18- bis 21-Jährigen verbüßen lebenslange Strafen. Unter den Häftlingen sind auch Mörder. Viele verbringen ihre Tage in den Zellenflügeln, es mangelt an sinnvoller Beschäftigung. Spannungen und Schikane zählen zum Alltag. Immer wieder gehen die Insassen so brutal aufeinander los, dass die Unterlegenen ärztlich versorgt werden müssen. In diesem Milieu organisierte der Forscher Bernard Gesch von der Universität Oxford vor einigen Jahren ein Experiment. Der Wissenschaftler hatte eine beinahe verrückt klingende Theorie: Gesch wollte testen, ob die Gefangenen friedlicher wären, wenn sie sich besser ernährten. Studien zeigen, dass Häftlinge oft einen höchst einseitigen Speiseplan haben - sie essen vornehmlich Weißbrot, Pommes frites, Süßigkeiten. Auf vitamin- und mineralreiche Kost wie Obst, Gemüse, Salat verzichten viele von ihnen.
Mit Einwilligung der Gefängnisleitung reicherte der Forscher die Versorgung einiger Insassen an. Sie aßen die gleichen Mahlzeiten wie zuvor, aber ergänzt durch eine Tablette mit Vitaminen, bestimmten Mineralstoffen und Fettsäuren. Die Erkenntnis: In den folgenden rund viereinhalb Monaten waren Gefangene, die diese Vitamine und Minera- lien zu sich nahmen, im Durchschnitt um 37 Prozent seltener in ernsthafte Zwischenfälle (darunter auch Gewaltakte gegen Mitinsassen) verwickelt als Gefangene mit Standardverpflegung.
Als Gesch und andere Wissenschaftler das Experiment in weiteren Haftanstalten in Großbritannien und den Niederlanden wiederholten, zeigte sich das gleiche Muster: Ernährten sich Insassen gesünder, waren sie weniger aggressiv.
"Die Zahl der Vorfälle reduzierte sich um 26 bis fast 70 Prozent", sagt Gesch. Die Untersuchungen beleuchten einen Aspekt, der den meisten Menschen kaum bewusst ist und den selbst Forscher lange Zeit übersehen haben: Essen ist weit mehr als die Zufuhr von Nährstoffen und Energie für den Körper. Was wir an Speisen und Getränken zu uns nehmen, versorgt nicht allein die Muskeln oder steuert die Fetteinlagerung - es wirkt sich auch ganz erheblich auf unser Gemüt aus.
In zahlreichen Studien haben Wissenschaftler in den vergangenen Jahren herausgefunden, dass Lebensmittel auf hochkomplexe Weise unsere Psyche beeinflussen. Vor allem vier Aspekte haben sie bisher identifiziert:
- Sinneswahrnehmung. Die Nahrungsaufnahme ist eine der wichtigsten Überlebensaufgaben überhaupt, so greift allein der Vorgang des Essens und Trinkens tief in Schaltkreise ein, die unsere Gefühle steuern. Schon der Geruch einer Speise, der Geschmack eines Getränks etwa können ganz unterschiedliche Empfindungen hervorrufen - von Lust und Freude bis zu Ekel und Überdruss.
- Unmittelbare Wirkung im Hirn. Manche Speisen enthalten Bestandteile, die vom Darm aufgenommen werden, über die Blutbahn das Gehirn erreichen und direkt auf das Denkorgan einwirken - fast wie Drogen. In Schokolade etwa stecken Substanzen, die den berauschenden Komponenten von Marihuana ähneln.
- Hormonsteuerung. Unsere Mahlzeiten liefern Zutaten für Botenstoffe, die unsere Emotionen regulieren. Zu einer Gruppe dieser Hormone, sogenannten Neurotransmittern, gehört beispielsweise Serotonin. Um dieses Hormon herzustellen, braucht der Körper ganz spezielle Moleküle - etwa bestimmte Aminosäuren, die in Lebensmitteln enthalten sind.
- Psychoaktive Bakterien im Darm. Was wir uns einverleiben, wirkt sich auf die Mikroben in unserem Darm aus. Die Einzeller ernähren sich von bestimmten Nahrungskomponenten und produzieren ihrerseits Substanzen, die sich womöglich auf unser Gemüt auswirken.
Es ist kaum zu glauben, aber: Jede Mahlzeit beeinflusst, wie wir uns fühlen. Manche Effekte verfliegen nach ein paar Minuten oder Stunden. Andere Ernährungsgewohnheiten prägen über Wochen, Monate, ja vermutlich sogar Jahre mit, wie niedergeschlagen oder zuversichtlich wir die Welt sehen oder wie wir mit Stress und Problemen umgehen. So groß scheint die Wirkung von Nahrung auf die Psyche, dass manche Forscher mittlerweile glauben, dass es möglich ist, sich ein neues Lebensgefühl buchstäblich herbeizuessen.
Nimmt man es genau, dann beeinflusst Nahrung unsere Psyche, noch ehe wir den ersten Happen überhaupt zum Mund geführt haben. Mit unseren Augen prüfen wir die Farbe und Form der Speisen, die auf dem Teller vor uns liegen. Mit unserer Nase ziehen wir die komplexen Aromen ein, die von der Mahlzeit aufsteigen. Blitzschnell durchforstet unser Gehirn den Speicher aus Erfahrungen und Assoziationen, die wir mit dem entsprechenden Essen verbinden: Haben wir etwas Vergleichbares schon einmal gekostet? Wenn ja: Wann und wo war das? Wie hat es uns geschmeckt? Und: Wie haben wir uns damals gefühlt?
Wenn wir zum Beispiel gestresst sind, vermag uns allein schon der Anblick und Geruch unserer Leibspeise merklich zu entspannen. Der dampfend warme Teller mit Spaghetti Napoli oder die knusprig-braune Kruste eines Schnitzels können Erinnerungen an die familiäre Geborgenheit von Mutters Küche oder an gemütliche Abende in einer Gaststätte aktivieren. Ohne dass wir uns dessen bewusst sein müssen, fühlen wir uns sicher, umsorgt, vielleicht gar ein wenig getröstet. Andere Mahlzeiten dagegen verstören uns. So machte viele US-Kriegsveteranen, die während des Zweiten Weltkrieges im Südpazifik in lebensbedrohliche Gefechte verwickelt worden waren, schon der Geruch von chinesischem Essen nervös - sogar noch 50 Jahre nach den traumatischen Kriegserlebnissen.

Und offenbar übt auch die Gesellschaft, in der wir uns befinden, einen Einfluss darauf aus, wie gut es uns schmeckt und wie gern wir essen. So fanden Forscher heraus: Wer mit zwei guten Freunden bei Tisch sitzt, verspeist durchschnittlich rund 40 Prozent mehr als allein.
Sitzen wir mit sieben oder mehr Vertrauten beisammen, verleiben wir uns sogar beinahe das Doppelte ein. Vermutlich vermögen wir im Beisein von Vertrauten besonders zu entspannen und haben mehr Appetit. Obendrein nehmen wir uns für gemeinsame Mahlzeiten häufig mehr Zeit - und lassen uns damit zu mehr Verzehr verleiten. Sobald wir uns entschieden haben, einen Bissen zum Mund zu führen, und zu kauen beginnen, prüfen Tausende Sinneszellen auf der Zunge (und später auch im Magen und Darm), aus welchen Ingredienzien die Speise besteht; ob sie Fett enthält, Kohlenhydrate und Eiweiße. Werden die empfindsamen Zellen gereizt, senden sie Signale und veranlassen unter anderem die Speicheldrüsen und den Magen, Verdauungssekrete zu produzieren. Enzyme im Speichel und im Magensaft zersetzen die Nahrungsbestandteile: Sie zerschneiden große Moleküle (darunter Eiweiße und Kohlenhydrate) in winzige chemische Bausteine - etwa in kurze Zuckerketten oder Aminosäuren - und schleusen die zerkleinerten Substanzen über die Schleimhäute des Darms in die Blut- oder Lymphbahnen.
Die verschiedenen Stoffe entfalten ganz eigene Wirkungen. Manchen Effekt bemerken wir rasch nach dem Verzehr: Die Aufnahme von Fett macht uns zum Beispiel einige Zeit darauf träge. Essen wir etwa Bratwürste, lässt uns das darin enthaltene Fett leicht müde werden. Den genauen Grund kennen Forscher noch nicht: Doch unser Körper scheint - nachdem wir uns fettige Kost einverleibt haben - Botenstoffe auszuschütten, die schläfrig machen.
Wer dagegen eine Tüte Gummibärchen nascht, bekommt nach 15 bis 30 Minuten einen Energieschub: Sobald der leicht verdauliche Zucker massenweise in Form von Glukose durch die Darmwand tritt und mit dem Blut zum Gehirn und den Muskeln strömt, hebt sich die Stimmung, steigt die Konzentrationsfähigkeit. Allerdings verändert sich das Hoch nach ein bis zwei Stunden wieder, dann schwindet der kurzzeitige Energieschub, nicht selten sind wir plötzlich eher unkonzentriert.
Der Grund: Die Muskeln und das Gehirn haben einen Großteil der Glukose aufgebraucht, der Zuckerspiegel im Blut fällt so rapide ab, wie er zuvor gestiegen ist. Und dabei verschlechtert sich oft auch merklich die Stimmung. Dies lässt sich vermeiden, wenn man anstelle von Süßigkeiten etwa Müsli mit Beeren isst. Denn Vollkorngetreide enthält komplexere Zuckermoleküle als Gummibärchen. Unser Verdauungstrakt braucht länger, um diese Moleküle in Glukose zu zerlegen. Und somit tritt die energiereiche Substanz langsamer durch die Darmwand ins Blut. Mithin verursacht der Verzehr keine extremen Ausschläge des Zuckerspiegels - und damit keine unangenehmen Schwankungen etwa der Konzentrationsfähigkeit.
Ein vorübergehendes Hoch verschaffen uns scharfe Speisen. Der biochemische Mechanismus dabei ist jedoch ein ganz anderer: Beißen wir in eine Chilischote, reizt etwa der darin enthaltene Wirkstoff Capsaicin die Zunge, es schmerzt fast so, als hätten wir uns verbrannt. Um die Qual erträglicher zu machen, schüttet das Hirn nun Stoffe zur Linderung aus: Diese Endorphine sind dem Betäubungsmittel Morphin ähnlich - sie dämpfen einerseits den Schmerz, andererseits versetzen sie uns in leichte Euphorie.

Bei manchen Lebensmitteln ist die Wirkung derart ausgeprägt, dass Menschen seit Jahrhunderten danach greifen, um ihre Gemütslage zu manipulieren. Die belebende Wirkung von Kaffee beispielsweise beruht darauf, dass das darin enthaltene Coffein Nervenzellen im Gehirn daran hindert, jene Botenstoffe zu erkennen, die eigentlich müde machen. Folglich fällt es uns leichter, wach zu bleiben. Und dass der Genuss von Schokolade manchen Menschen dabei hilft, die Welt gelassener zu sehen, war auch schon bekannt, lange bevor Lebensmittelchemiker die mögliche Ursache entschlüsselt haben: Kakaobohnen enthalten zahlreiche psychoaktive Substanzen, etwa Anandamide. Diese Stoffe lagern sich an die gleichen Stationen im Gehirn an wie die berauschenden Bestandteile von Marihuana. Zwar rufen die Anandamide keine Halluzinationen hervor wie Cannabis (zudem ist ihre Konzentration in Schokolade sehr gering): Dennoch reichen vielen Menschen einige Bissen aus, damit sich eine wohltuende Entspannung einstellt.
Dies ist ein Auszug des Artikels "Wie Essen unser Fühlen bestimmt". Den ganzen Text lesen Sie in GEOkompakt Nr. 42 "Gesunde Ernährung". Das Heft können Sie online bestellen.