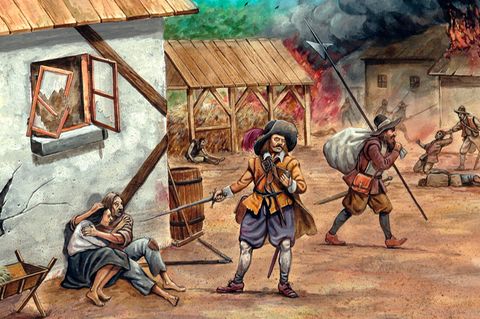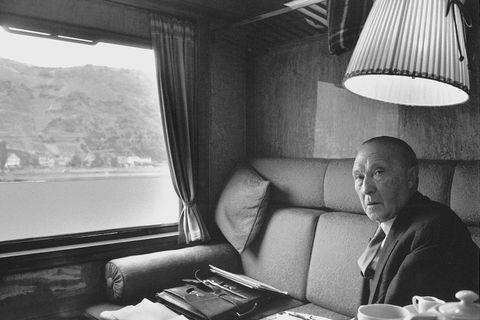Welthauptstadt der Hochtechnologie
In nur drei Jahrzehnten ist die alte Residenz-, Beamten- und Garnisonsstadt nach der deutschen Reichsgründung 1871 zur modernsten und am raschesten wachsenden Metropole Europas geworden.
"Berlin ist Spekulation, ungesunde Tempobeschleunigung, die Stadt schießt hinein ins Auswärts, sie kommt nicht gütig oder werbend", klagt später der Nationalökonom Alfons Goldschmidt. "Sie reißt Landstücke an sich, sie pfropft ihre Hässlichkeiten hinein."
"Spree-Athen ist tot, und Spree-Chicago wächst heran", meint der Großindustrielle und spätere Außenminister Walther Rathenau. Und Mark Twain hält Chicago im Vergleich mit Berlin für "geradezu ehrwürdig. Die Hauptmasse der Stadt macht den Eindruck, als wäre sie vorige Woche erbaut worden".
Welthauptstadt der Hochtechnologie
Rund um die Kapitale wachsen Schornsteine in die Höhe. Berlin ist das größte Industriezentrum Deutschlands, Standort von Borsig, der Agfa sowie der beiden Elektroriesen Siemens & Halske und AEG - Unternehmen, die Berlin zur Welthauptstadt der Hochtechnologie gemacht haben. Die Produktionsanlagen werden so groß, dass sie ins Umland abwandern müssen.
Jahr für Jahr nimmt die Metropole Massen von Zuwanderern auf. Jeder Zweite in Berlin sieht aus, als wäre er eben erst aus dem Zug gestiegen - desorientiert und entschlossen zugleich. Der echte Berliner ist nicht in Berlin geboren. Der kommt aus Brandenburg, Ostpreußen und Schlesien.
Binnen 30 Jahren 140 Prozent mehr Einwohner
Viele Neuankömmlinge sind Juden aus den preußischen Provinzen oder aus den Ländern Osteuropas. Im Jahr der Reichsgründung hatte die neue Hauptstadt 826341 Einwohner; am 1. Dezember 1900 werden 1.888.848 Berliner gezählt. 1905 leben mehr als zwei Millionen Menschen in der Stadt. Die viel zitierte Verdoppelung "Berlin! Berlin!" steht für das Berliner Tempo. "Die elektrischen Wagen und die Trams bilden eine ununterbrochene Linie", schreibt die Baronin Spitzemberg in ihr Tagebuch. "Wagen aller Art, Droschken, Drei- und Zweiräder zu Hunderten fahren neben-, vor-, hinter- und oft aufeinander, das Läuten aller dieser Vehikel, das Rasseln der Räder ist ohrzerreißend, der Übergang der Straßen ein Kunststück für den Großstädter, eine Pein für den Provinzler."
Europas autoverrückteste Stadt
Die erste elektrische Straßenbahn der Welt startet 1881 in Lichterfelde. Die neue, Zug um Zug eingeführte Stadtbahn ist Europas erste Hochbahn überhaupt. Unter ihren Ziegelarkaden richten sich Läden und Gastwirtschaften ein. Während oben die Züge rollen, bestellt man eine Etage tiefer die nächste Molle. 1896 ist mit dem Bau des U-Bahn-Netzes begonnen worden. Und trotz seiner hoch entwickelten Verkehrsmittel, trotz zehn Fernbahnhöfen ist Berlin eine der autoverrücktesten Städte Europas. 1902 muss der erste Polizist zur Verkehrsregelung auf den "Linden" abgeordnet werden. "Sähe ein Unbeteiligter, Ruhiger von irgendwoher hinein in dieses unablässige Rollen, Tuten, Drängen, Rufen, Scharren, Klingeln, in dieses Vorwärtsschieben und Umherwimmeln", notiert ein Beobachter, "es müsste ihm vorkommen, als jage ein böser Dämon alle diese Menschen dort im Kreise umher." Nervosität und Übererregung sind die typischen Krankheiten der Großstadt.
Stickige Arbeiterviertel
Aber in Berlins Norden und Osten, in den heruntergekommenen Arbeitervierteln, wo geht es hier schon aufwärts? Wohnungen sind knapp. Die Nachfrage übersteigt ständig das Angebot. Und eine skrupellose Grund- und Bauspekulation sorgt dafür, dass es auch so bleibt. Wer kein Geld hat, der strandet in den Mietskasernen-Vierteln im Wedding oder in der Luisenstadt (im heutigen Kreuzberg), in Neukölln, in Friedrichshain. Oder es verschlägt ihn in das Gewirr schmaler und feuchter Gassen des Scheunenviertels nördlich des Alexanderplatzes, das als die verrufenste Gegend Berlins gilt. Hier ist die niederste Prostitution zu Hause, kleine Händler betreiben armseliges Gewerbe, und jüdische Einwanderer aus Russland oder Polen suchen eine erste Unterkunft. Abweisend, zweckmäßig und eintönig, haben die Mietskasernen in der Tat viel gemein mit Soldatenunterkünften. Vier bis sechs Stockwerke sind sie hoch, quadratisch um einen Innenhof angelegt und sich in die Tiefe vervielfachend. Die Hinterhöfe sind düster und stickig, erfüllt vom Lärm der kleinen Handwerksbetriebe.
Überbelegte Wohnungen
Das Klopfen, Hämmern und Sägen aus den Werkstätten übertönt den ganzen Tag hindurch Kindergeschrei und das Rufen und Schwatzen der Mütter. Hier stehen überquellende Mülleimer und oft auch der Abort. Nach der Berliner Bauordnung, die bis 1887 gilt, brauchen die Hinterhöfe nur eine Länge und Breite von je 5,30 Meter zu haben - so groß, dass der Spritzenwagen der Feuerwehr darin eben wenden kann.
"Kaum irgendwo in der Welt wohnt man so dicht; es ist, als ob nicht für Menschen Unterkunft geschaffen werden sollte, sondern für Maulwürfe", ist in der Zeitschrift "Die Zukunft" zu lesen. Die Wohnungszählungen von 1900 und 1905 bringen Zustände zutage, die den sozialdemokratischen Abgeordneten Albert Südekum zu dem Schluss kommen lassen: "Man kann einen Menschen mit einer Wohnung geradeso gut töten wie mit einer Axt."
40 Personen pro Toilette
Um 1895 leben in Berlin 43,7 Prozent der Bevölkerung in Wohnungen mit nur einem beheizbaren Zimmer, das in der Regel gleichzeitig als Küche, Wohn- und Schlafstube dient. Die Gemeinschaftstoilette auf dem Treppenpodest oder im Hof wird manchmal von mehr als 40 Personen benutzt. Licht und Luft kommen oft allein über Lichtschächte - wenn die Wohnung nicht gleich im lichtlosen Keller liegt. Drangvolle Enge herrscht überall. Kinder, Kranke, zwischendrin viel zu schnell gealterte
Frauen, die als Heimarbeiterin etwas dazuverdienen versuchen.
Für sieben Pfennig die Stunde, selten mehr, nähen sie für einen Zwischenhändler Kindermäntel mit Pelerinen oder Malerkittel. Bis zur Erschöpfung wird die auf Raten gekaufte Nähmaschine getreten. Oder sie fabrizieren Hüte, Kunstblumen, Knallbonbons.
"Schlafburschen" als Untermieter
Um ihre Miete bezahlen zu können, sind viele gezwungen, in den ohnehin schon überfüllten Wohnungen "Schlafburschen" aufzunehmen. Dann müssen die Kinder zusammenrücken, auf zusammengeschobenen Stühlen schlafen oder auf dem Fußboden, um Platz für den zahlenden Schlafgänger zu schaffen.
Hier stinkt es nach Armut, nach verbranntem Kohl und billigem Schnaps, nach Schweiß und feuchten Wänden. Der Armenarzt behandelt Dirnen, die von Zuhältern geprügelt werden, und an Sommerdiarrhöe leidende Kinder - Folge verdorbener Milch und schlechter Luft in den überhitzten Mietskasernen. Er kümmert sich um Schwindsüchtige und Geschlechtskranke.
Tausende Obdachlose
An den üblichen "Ziehtagen", zum 1. April und 1. Oktober, herrscht stets ein reger Umzugsverkehr. Beladen mit ihren wenigen Habseligkeiten, ziehen die Berliner von einer trostlosen Wohnung in eine noch trostlosere - womöglich in einen Keller oder einen soeben fertig gestellten, noch feuchten Neubau.
"Trockenwohner" nennt man jene Mieter,die eine frischverputzte Wohnung gerade so lange beziehen, bis sie ausgetrocknet genug ist und zahlungskräftigeren Mietern angeboten werden kann.
Viele fallen ganz durch die weiten Maschen des sozialen Netzes. Obdachlosen, die von einem der überfüllten Asyle abgewiesen werden, bleibt nur, bei "Mutter Grün" zu nächtigen. An einem einzigen Tag, dem 30. Januar 1895, nimmt eine "Wärmehalle", ein Tagesasyl für Obdachlose, 4000 Personen auf. Wöchentlich veröffentlichen die Zeitungen die Liste der Selbsttötungen.
Berlins feinste Adresse
Berlin ist eine geteilte Stadt. Hier Heinrich Zilles "Milljöh", der triste, in seinem Elend verharrende Norden und Osten, das "dunkle Berlin", dort der glänzende Westen, das Berlin der Aufsteiger. Proper, blitzend und aufgeräumt präsentiert die junge Hauptstadt, die 1126 Straßenkehrer beschäftigt, ihre schmucke Seite. Und nirgendwo ist es so sauber, so blank wie Unter den Linden. Schaufenster prunken mit Luxusauslagen. Die Wände des Café Bauer hat der vom Kaiser so geschätzte Historienmaler Anton von Werner mit Szenen aus dem alten Rom bemalt.
Zwischen Café Bauer und Pariser Platz machen sich "Palazzi prozzi" breit: die Geschäftshäuser der Disconto-Gesellschaft, der Preußischen Central-Bodenkredit-AG, der Internationalen Eisenbahn-Schlafwagen-Gesellschaft. Und schließlich am Pariser Platz der Prunkbau des Hotel "Adlon".
Die größte Sehenswürdigkeit: der Kaiser
"Laufstraße" nennen die Berliner Unter den Linden, "Saufstraße" die Friedrichstraße, "Kaufstraße" die Leipziger Straße. In die Leipziger geht man zum "Shopping" - "eine neue Sitte in Berlin", wie das "Berliner Tageblatt" berichtet, bei der die Damen "ohne die geringste Absicht des Kaufens sich die neuesten Kreationen vorlegen lassen". Hier befindet sich das 1897 eröffnete Kaufhaus Wertheim mit seiner gotisch stilisierten Fassade, ein Tempel des Massenkonsums. Und schnell das populärste Bauwerk Berlins.
Die größte Sehenswürdigkeit aber ist der Kaiser: "Berlin jewesen - Kaiser jesehen." In der Lokalpresse und in Stadtführern wird angezeigt, wann und wo die Untertanen den Monarchen bestaunen können: an Festtagen bei Paraden und Denkmalsenthüllungen; alltags bei Ausritten Unter den Linden, meist zu fester Stunde. Oder er braust im Daimler-Wagen vom Schloss zum Brandenburger Tor.
Die Begeisterung fürs Militär
Tausende von Berlinern stehen Spalier oder ziehen im Gleichschritt mit, wenn das Gardekorps zur Frühjahrs- oder Herbstparade auf dem Tempelhofer Feld ausrückt. Und an der Spitze reitet Wilhelm II.
"Militärtoll" nennt eine französische Zeitung die Berliner. Reserveleutnant zu sein hebt die gesellschaftliche Reputation und fördert die Karriere. Die "besseren Kreise" bauen jetzt im Grunewald, in Dahlem oder am Wannsee. Ein griechisch-italienisches Palais vielleicht,dessen Dekor-überladenes Mobiliar mehr zum Repräsentieren als zum Wohnen geeignet ist. Wo zuvor ein Knüppeldamm durch sumpfiges Gelände führte, auf dem Kurfürsten, Könige und ihre Jagdgesellschaften zum Jagdschloss Grunewald ritten, ist nach dem Vorbild der Pariser Champs-Elysées eine Prachtstraße entstanden: der Kurfürstendamm.
Hier werden Millionäre gemacht
Nun wohnen hinter pompösen Treppenaufgängen und Fassaden im "neuen Westen" die Repräsentanten des alten wie des neuen Reichtums. Hier hängen Schilder "Nur für Herrschaften!" 1913 werden im "Jahrbuch der Millionäre" allein 120 ganz Reiche am Kurfürstendamm registriert - und ungefähr noch einmal so viele in den umliegenden Straßen. Keine andere Einkommensgruppe wächst in diesen Jahren so rasch wie die der wirklich Vermögenden. Aber auch für den Mittelstand werden neue Wohnviertel aus dem Boden gestampft - in Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf, Steglitz und Tempelhof, wo eben noch Rittergüter lagen. Der Bauwut weichen auch die Äcker der Schöneberger Kartoffelbauern, die der Verkauf zu Millionären macht.
20 000 Prostituierte
In der Friedrichstraße konzentrieren sich die Nachtlokale, Tanzbars und Animierkneipen, die der Stadt den Ruf eines Sündenbabel eintragen, in das der brave Provinzler nur mit frommem Schauder (und heimlicher Sehnsucht) fährt. In der Friedrichstadt stehen die Huren. Sie tragen Federhüte, Federboas und hochgeschnürte Busen und schwenken ihre Taschen hin und her. 1900 gehen nach Schätzungen der Polizei in Berlin 20000 Frauen der Prostitution nach. Ein großer Teil hat zuvor versucht, als Hausmädchen über die Runden zu kommen. Ihre Zuhälter gehören oft "Ringvereinen" aus dem Halbweltmilieu an. Die organisieren kleinere Untergruppen, die sich auf Geschäftsfelder wie Drogenhandel, Prostitution oder Auftragsmord spezialisieren. Vereinsmitglied wird nur, wer mindestens zwei Jahre im Gefängnis verbracht hat. Und die Mitgliedschaft lohnt sich: Der Verein stellt nicht nur ausgezeichnete Rechtsanwälte. Wenn es sein muss, sorgt er dafür, dass wichtige Zeugen und Richter bestochen werden.
Armut als Gesellschaftsspaß
Seit 1925 feiert Berlins feine Gesellschaft "Zille-Bälle". So wie in den Zeichnungen des berühmten "Milljöh"-Malers gefällt sich der Herr Bankdirektor dann als Ganove mit Ballonmütze und gemaltem Messerstich auf der Wange. Seine Frau spielt die Hure - mit Netzstrümpfen und einem Ausschnitt, der alles verspricht. Die Blaskapelle spielt eine Zille-Polonaise. Die Aufsteiger begeben sich Champagner trinkend für eine Nacht hinab in Zilles "Milljöh".
Nur Zilles Personal bleibt, wo es immer schon war, draußen, auf der dunklen Seite von Berlin.