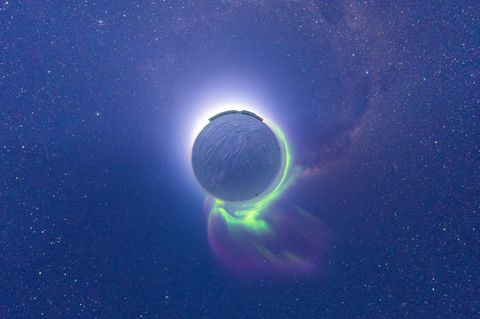Das Vertrauen in Forschende und in die Wissenschaft hat in der Covid-19-Pandemie gelitten – zumindest in Deutschland. Doch nicht überall auf der Welt hat das Vertrauen gleichermaßen gelitten. Das zeigt eine Befragung von 71.417 Menschen in 67 Ländern.
Demnach ist das Vertrauen in die Forschung im Schnitt groß. Am höchsten ist es überraschenderweise in Ländern, die aus westlicher Perspektive in puncto Wissenschaft oft eher als Schwellenländer wahrgenommen werden. So genießt die Wissenschaft von allen Ländern in Ägypten das höchste Vertrauen, gefolgt von Indien und Nigeria. Schlusslichter der Studie sind demnach Albanien, Kasachstan und Bolivien. Im Vergleich zum Gesamtergebnis "unterdurchschnittlich" ist das Vertrauen in technologisch weit entwickelten Ländern wie Deutschland, Hongkong und Japan.
Die vorab veröffentlichte Studie des Teams um die Sozialwissenschaftlerin Viktoria Cologna von der Leibniz Universität Hannover ist die größte dieser Art seit Ausbruch der Pandemie.
Wie erklärt sich diese zunächst verblüffende Reihenfolge? Einen Hinweis fanden die Forschenden in den Antworten der Befragten zur politischen Orientierung. Während sich in 41 der untersuchten Länder kein klarer Trend abzeichnete, war der Befund in den restlichen 26 Nationen eindeutig: Das Vertrauen der Menschen in die Wissenschaft ist kleiner, wenn sie sich auf der politischen Skala eher rechts verorten – und umgekehrt. Und offenbar ist es rechten Parteien in manchen Ländern während der Pandemie "gelungen", die Forschung in Misskredit zu bringen.
Welche Rolle die Religionszugehörigkeit spielt
Neben politischen Überzeugungen scheint auch die Konfession einen Einfluss auf das Vertrauen in Wissenschaft zu haben. So sehen sich Muslime in Ländern wie Türkei, Bangladesh oder Malaysia angesichts der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung kaum in Konflikte mit ihrer religiösen Weltanschauung gestürzt. Anders in Israel oder in den christlich geprägten Ländern der Europäischen Union. Viele Menschen hier stören sich an offenkundigen Widersprüchen zwischen Forschung und Religion.
Fast beruhigend wirkt dagegen der Befund der Forschenden, dass insgesamt immerhin drei Viertel der Befragten zustimmten, dass die wissenschaftliche Methode der beste Weg ist, um herauszufinden, was wahr ist.
Einen Grund zum Zurücklehnen sehen die Forscher allerdings nicht. Sie sorgen sich, "dass der Mangel an Vertrauen in die Wissenschaft, auch wenn er nur eine Minderheit betrifft, die Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei der politischen Entscheidungsfindung beeinträchtigen könnte".
Was bedeutet das für die Forschenden? Sie könnten von Kommunikationstrainings profitieren, um für den rauen Umgang in der politischen Arena gerüstet zu sein, erklärt der an der Studie nicht beteiligte Psychologe James Liu im Fachmagazin "Nature". Für viele sei die politische Wortmeldung ein "Vollkontaktsport". Gerade Klimaforschende, die sich ins Rampenlicht öffentlicher Debatten stellen, können davon ein Lied singen. So erhielt der US-Forscher Michael E. Mann jüngst von einem Gericht umgerechnet fast 930.000 Euro zugesprochen, nachdem er von zwei rechten Autoren mit einem Kinderschänder verglichen worden war, der Klimadaten "missbraucht und gefoltert" habe.