Alles wird immer schlechter? Unsere Zähne nicht! Die Gebisse der Kinder in Deutschland: zu 80 Prozent kariesfrei; selbst im internationalen Vergleich stehen sie damit blendend da. Fast alle 40-Jährigen unter uns kauen noch auf meist 28 eigenen Zähnen, 8,6 davon gefüllt, so die jüngste "Deutsche Mundgesundheitsstudie". Auch Hochbetagte können heute originale Zähne zeigen, guter Pflege und Flickerei sei Dank. Also: weiterputzen, am besten zweimal täglich "fegend". Das erspart nicht nur quälende Behandlungen beim Zahnarzt, sondern möglicherweise auch Termine in der Herz- oder Hirnchirurgie; aber dazu später mehr.
Zunächst zurück, nicht weit. Denn kaum 200 Jahre ist es her, da gingen die meisten mit leeren Mundhöhlen ins Grab; auch weil man, vor allem nach Schlachten, Verstorbenen verbliebene Zähne zog und sie Dritten als Dritte verkaufte. Schon junge Menschen hatten einen mangelhaften, miefenden Zahnstatus, Bettler wie Königinnen. Bei Hofe waren Fächer en vogue, um sich frische Luft zu- und den fauligen Atem wegzuwedeln.
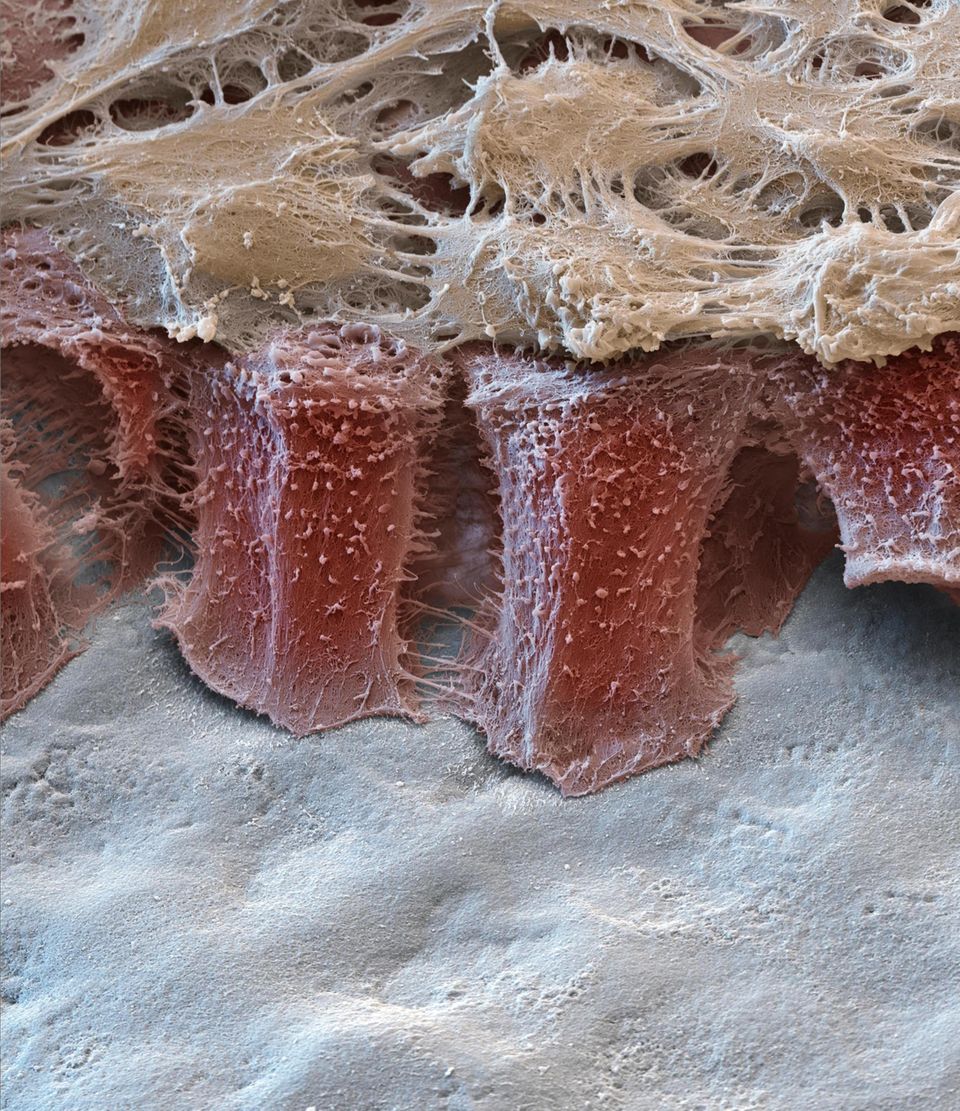
Ja, wer sich mit Zähnen beschäftigt, kann den Eindruck gewinnen, sie hätten uns nur Schmerz und Scham eingebracht. Aber das stimmt nicht. Am Ende haben sie uns sogar schlau gemacht. Schon vor rund 400 Millionen Jahren schwammen erste zahnbewehrte Wesen, Panzerfische der Ordnung Acanthothoraci, in den Meeren, deren Beißer sich im Prinzip bewährten. Doch die Fähigkeit, Nahrung schon im Mund zerkleinern, also kauen, und dabei aufspalten zu können, wurde erst viel später durch pflanzenfressende Säugetiere, zu denen auch die Affen zählen, perfektioniert. Ein Glücksfall für uns.


![Hirnforschung: "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert](https://image.geo.de/37054408/t/nc/v16/w480/r0.75/-/migraene-cover.jpg)





















