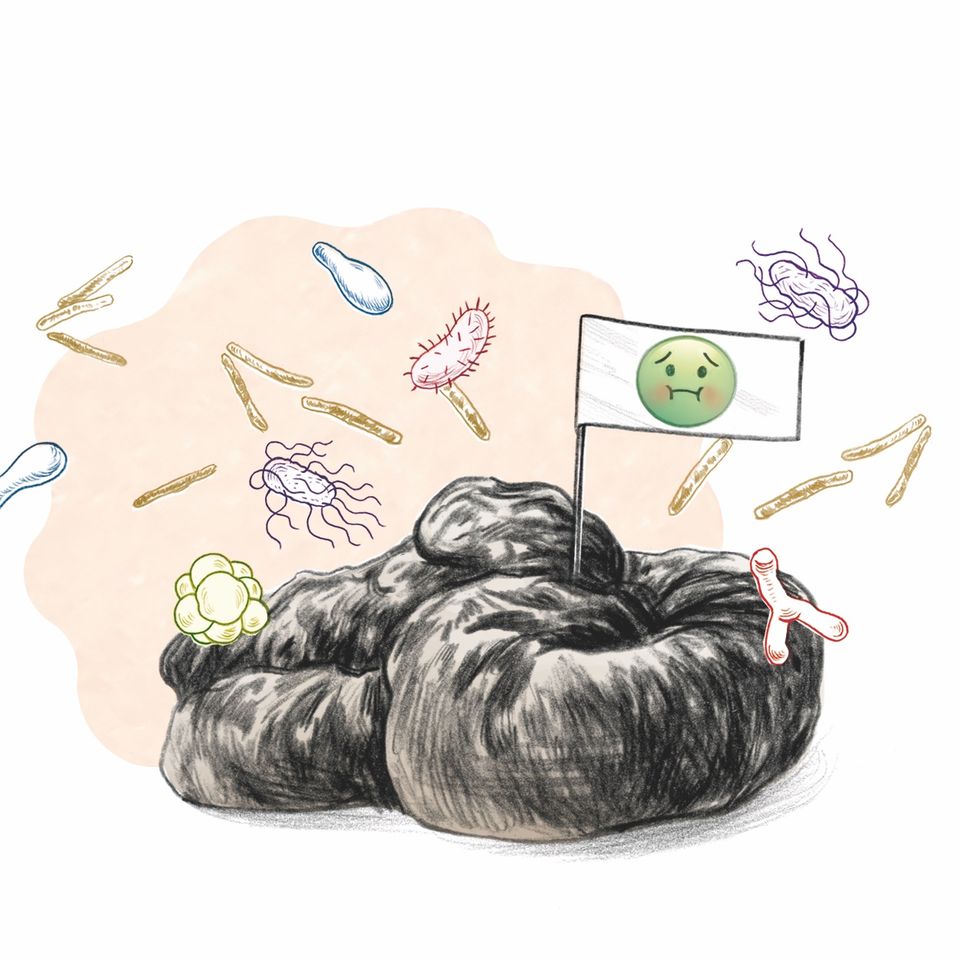Es ist schon kurios, dass das Zustandekommen von etwas so Alltäglichem noch nicht restlos aufgeklärt ist. Tatsächlich ist es Forschenden aber erst jetzt gelungen, vollends zu entschlüsseln, was Urin seine gelbe Farbe verleiht.
Diese Entdeckung sei von enormer Bedeutung für unsere Gesundheit, wie sie im Fachmagazin "Nature Microbiology" schreiben. Und sie ist ein spannendes Lehrstück darüber, wie das Zusammenspiel zwischen unserem Körper und seinen winzigen Darmbewohnern funktioniert – und was passieren kann, wenn dabei etwas schiefläuft.
Der Farbstoff im Urin stammt ursprünglich von roten Blutkörperchen
Schon länger war bekannt, dass der gelbe Farbstoff im Urin letztlich ein Abbauprodukt roter Blutkörperchen ist. Die haben im Schnitt nach 120 Tagen ausgedient und werden dann in der Leber in ihre Bestandteile zerlegt. Dabei wird der rote Farbstoff der Blutkörperchen, das Hämoglobin, zunächst in eine orangefarbene Substanz mit dem schillernden Namen "Bilirubin" umgebaut.
Über die Galle wird Bilirubin anschließend in den Darm befördert. Dort wird es unter anderem zu Urobilinogenen umgewandelt. Der Großteil davon wird zu Substanzen weiterverarbeitet, die Kot seine bräunliche Farbe verleihen.
Etwa einem Fünftel der Urobilinogene aber ist ein anderer Weg bestimmt: Sie werden wieder ins Blut aufgenommen und erneut in der Leber verarbeitet. Bei diesem letzten Schritt entstehen jene gelb färbenden Stoffe, die dann mit dem Urin über die Blase ausgeschieden werden.
Nur: Lange Zeit kannte man lediglich den Anfang und das Ende dieser langen Stoffwechselkette. Was genau in der Mitte, im Darm, geschieht, wie also Bilirubin zu Urobilinogenen umgewandelt wird, war eine Blackbox.
Nach jahrelanger Detektivarbeit wurden die Forschenden fündig
Erst die Forschenden um Brantley Hall von der University of Maryland entdeckten das für die Umwandlung verantwortliche Enzym, das sie "Bilirubin-Reduktase" nennen. Die Entdeckung war mit einigem Aufwand verbunden. Denn das Enzym wird von Darmbakterien hergestellt, die bei Kontakt mit Sauerstoff "binnen Minuten oder sogar Sekunden sterben", erklärt Hauptautor Brantley Hall gegenüber dem Nachrichtenportal Popular Science. Dementsprechend schwierig sei es gewesen, die Bakterien im Labor zu kultivieren. Es hat buchstäblich Jahre gedauert und wohl auch einiges gekostet, bis es endlich geglückt ist.
Nachdem sie die richtigen Bakterien identifiziert hatten, verglichen die Forschenden das Erbgut dieser Bakterien mit solchen, die Bilirubin nicht verarbeiten können. Das führte sie letztlich zu dem Gen für das Enzym "Bilirubin-Reduktase" – und zu dem Enzym selbst.
Um zweifelsfrei zu beweisen, dass sie auch wirklich das richtige Enzym gefunden hatten, fügten die Forschenden das Gen in das Erbgut von E.-coli-Bakterien ein, die normalerweise kein Bilirubin verarbeiten können. Diese Bakterien leben ebenfalls im Darm, vertragen aber Sauerstoff und sind daher leicht im Labor zu kultivieren. Und siehe da: Mit dem neuen Gen ausgestattet, verwandelte E. coli prompt Bilirubin zu Urobilinogenen.
Die Bedeutung dieser Entdeckung kann man laut Hall gar nicht hoch genug schätzen: "Das Darmmikrobiom ist voll von unglaublichen Chemikalien. All diese Moleküle, die die Darmmikroben herstellen, sind so wichtig für die menschliche Physiologie", erklärt Hall gegenüber PopSci. "Wenn wir mehr über die mikrobielle Chemie in unserem Darm verstehen, werden wir auch die wichtigen Dinge verstehen."
Könnte die Farbe des Urins etwas mit Reizdarm zu tun haben?
Doch welchen praktischen Nutzen hat die neue Erkenntnis? Auch hierauf haben die Forschenden eine Antwort: Sie fanden heraus, dass die Bilirubin verarbeitenden Bakterien zur Gruppe der Firmicutes gehören. 99,9 Prozent der Erwachsenen haben diese in ihrem Darm. Sie scheinen also ziemlich wichtig zu sein.
Es gibt aber eine kuriose Ausnahme: Menschen mit chronischem Reizdarmsyndrom beherbergen nur zu 68 Prozent die Bilirubin-Bakterien, wie die Forschenden herausfanden. Möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang, der sich zu erforschen lohnt und zu neuen Behandlungen führen könnte.
Wie wichtig der Abbau von Bilirubin ist, zeigt sich auch daran, was passiert, wenn dabei etwas schiefläuft. Ist etwa die Leber oder Galle schwer entzündet, macht sich das ziemlich schnell bemerkbar: Der Stoff reichert sich dann im Blut an und färbt die Haut gelb. Mediziner sprechen von "Gelbsucht". Auch Neugeborene, deren Darmmikrobiom noch nicht ausgereift ist, leiden häufig unter Gelbsucht. Auch bei ihnen fehlen auffallend oft die Bilirubin-Bakterien im Darm, stellten die Forschenden fest.
Bestimmte Krankheiten zeigen sich auch im Urin
Eine weitere Frage, die sich viele Menschen in diesem Zusammenhang stellen: Was sagt die Farbe des Urins eigentlich über unsere Gesundheit aus? Tatsächlich sehr viel. Deshalb gilt die Urinprobe als wichtiges Diagnoseinstrument, wenn der Verdacht besteht, dass mit einem Organ etwas nicht stimmt. Folgendes lässt sich aus der Farbe ablesen:
Wenn jemand zu wenig trinkt und in der Folge wenig Urin produziert, konzentriert sich der gelbe Farbstoff im Ausscheidungssaft: Er wird dunkelgelb. Viel Trinken verdünnt dagegen den Urin: Er erscheint hellgelb bis durchsichtig. Ist der Urin also sehr gelb, kann dies auf Flüssigkeitsmangel hindeuten. Trinken sollte das Problem zügig beheben.
Darüber hinaus können auch Farbstoffe aus der Nahrung, aus Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten den Urin gelb oder orange färben. Dies ist der Regel in der Packungsbeilage vermerkt.
Eine rote Farbe dagegen deutet auf Blut im Urin hin und kann Hinweis auf eine Entzündung, auf Harnsteine oder eine ernsthafte Erkrankung sein. In dem Fall sollte man umgehend einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.
Eine grünliche oder bläuliche Farbe deutet ebenfalls auf eine Infektion mit Erregern hin, die gefärbte Stoffwechselprodukte ausscheiden.
Eine orangefarbene bis bräunlich-gelbe Färbung lässt vermuten, dass Bilirubin ohne Umwandlung direkt in den Urin abgegeben wurde. Auch das kann auf Probleme, vor allem mit der Leber, hindeuten.
Eine braun-schwarze Farbe kann ein Hinweis auf ein seltenes Melanom sein. Oder abermals auf Stoffe in der Nahrung oder Medikamente, etwa Eisenpräparate, zurückgehen. Im Zweifel ärztlich abklären lassen.
Ein trüber oder schaumiger Urin ist ein Zeichen von zu viel Eiweiß im Urin. Dahinter kann ein Nierenleiden oder eine Infektion stecken.
Urin ist also ein komplexes Gemisch an Substanzen, die einen langen Weg in unserem Körper zurückgelegt haben. Daher kann er uns erstaunlich viele Informationen über unser Wohlergehen geben – und das mehrmals am Tag.