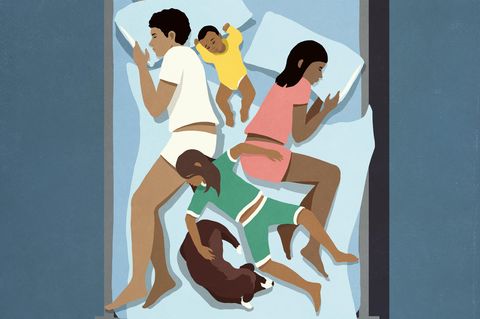Träume bergen noch immer viele Rätsel. Während etwa manche Menschen nachts in komplett neue Identitäten schlüpfen, von Ganoven verfolgt, von Monsterwellen erfasst oder – schlimmer noch – zu Schülern werden, die mit leerem Kopf vor einer Matheklausur sitzen, sind sich andere nicht einmal sicher, ob sie überhaupt etwas geträumt haben. Zwar steht fest, dass so gut wie jeder Mensch träumt, aber warum erinnern sich manche am nächsten Morgen detailliert an ihre nächtlichen Abenteuer, während andere beim Wachwerden eine "Traumamnesie" überfällt?
Forschende der IMT Schule für Höhere Studien Lucca und der Universität in Camerino in Italien sind der Antwort im Fachmagazin "Communications Psychology" jetzt ein Stück näher gekommen. Für ihre Studie rekrutierten sie mehr als 200 Menschen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren.
Während der Coronapandemie gab es vermehrte Traumberichte
Die Probanden wurden gebeten, 15 Tage lang nach dem Aufwachen in ein Aufnahmegerät zu sprechen, was sie in der Nacht zuvor geträumt hatten. Zudem wurde ihre Schlafqualität durch einen Aktigraphen erfasst (eine Art Smartwatch, die die Schlafaktivität misst). Psychometrische Tests gaben Aufschluss über kognitive Merkmale wie Gedächtnisleistung, Tagesfantasien oder Ängstlichkeit.

Auf diese Weise wollten die Forschenden frühere Studienergebnisse überprüfen, wonach Frauen, junge Menschen und jene, die zum Tagträumen neigen, ihre Nachtfantasien am nächsten Morgen besser erinnern. Bislang war die Datenlage hierzu widersprüchlich. Auch ob bestimmte Persönlichkeitsmerkmale oder kognitive Eigenschaften die Fähigkeit Träume zu rekapitulieren beeinflussen, ist umstritten.
Wer für Träume aufgeschlossen ist, erinnert sich auch besser
Zuletzt hatte das Thema während der COVID19-Pandemie für Aufsehen gesorgt, weil Menschen weltweit verstärkt von Traumerinnerungen berichteten. In diesem Zeitraum ist auch die aktuelle Studie entstanden. Der zufolge variiert die Fähigkeit, sich an Träume zu erinnern, stark von Person zu Person. Dennoch konnten die Forschenden bedeutsame Unterschiede ausmachen.
So fördert anscheinend vor allem eine positive Grundhaltung gegenüber Träumen die Erinnerung an Nachtfantasien. Allerdings ist auch denkbar, dass aufgeschlossene Menschen eher Techniken anwenden, um die Traumerinnerung zu fördern, wie zum Beispiel ein Traumtagebuch führen. Umgekehrt könnte, wer sich lebhaft an seine Träume erinnert, eher aufgeschlossen für deren Inhalte sein. Ursache und Wirkung sind in diesem Fall nicht ganz eindeutig. Neben der persönlichen Einstellung stehen auch längere Leichtschlafperioden und kürzere Tiefschlafphasen im Zusammenhang mit einer besseren Traumerinnerung.
Tagträumen fördert die Traumerinnerung
Auch die Tendenz zum Tagträumen ging mit einer besseren Traumerinnerung einher. Die Forschenden schreiben, dass man schon länger vermutet, dass dabei ähnliche Hirnregionen aktiv sind wie beim nächtlichen Träumen, allen voran das "default mode network" (DMN). Es spielt außerdem eine Rolle bei der Selbstbeobachtung und Gedankenprozessen.
Tagträumen ist jedoch nicht gleichzusetzen mit Ablenkbarkeit. Denn die wiederum stand der Traumerinnerung im Weg. Wer nach dem Aufwachen erstmal den Wecker suchen muss, sich mit dem Partner unterhält oder die To-do-Liste für den Tag durchgeht, bei dem reißt der Traumfaden vermutlich schnell wieder ab, so die Forschenden.
Auffällig war zudem der Zusammenhang zum Lebensalter: Während jüngere Menschen sich häufiger detailliert an ihre Träume erinnerten, wussten ältere Menschen oft nur noch, dass sie geträumt hatten, konnten sich Details aber nicht mehr ins Bewusstsein rufen. Die Forschenden vermuten, dass altersbedingte Veränderungen der Gedächtnisprozesse im Schlaf für solche "white dreams", also Traumerinnerungen ohne Inhalt, verantwortlich sind.
Fördert Frühjahrsmüdigkeit die Traumerinnerung?
Überraschenderweise spielte auch die Jahreszeit eine Rolle. Im Winter konnten sich die Probanden an weniger Träume erinnern als im Frühling oder Herbst. Womöglich, so die Autoren, beeinflussen Umweltfaktoren oder der Schlaf-Wach-Rhythmus das Traumgeschehen. Unterschiede zwischen den Geschlechtern haben sich indessen nicht bestätigt.
"Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Traumerinnerung nicht nur eine Frage des Zufalls ist, sondern ein Spiegelbild des Zusammenspiels von persönlichen Einstellungen, kognitiven Merkmalen und Schlafdynamik", erklärt der Hauptautor Giulio Bernardi, Professor für allgemeine Psychologie an der IMT Schule in einer Pressemitteilung der Universität. Koautorin Valentina Elce fügt hinzu, dass die in der Studie gewonnenen Daten zudem helfen könnten, zu erforschen, inwieweit veränderte Traumerinnerungen auf Krankheiten hinweisen. Möglicherweise könnten Träume so eines Tages der Früherkennung dienen.