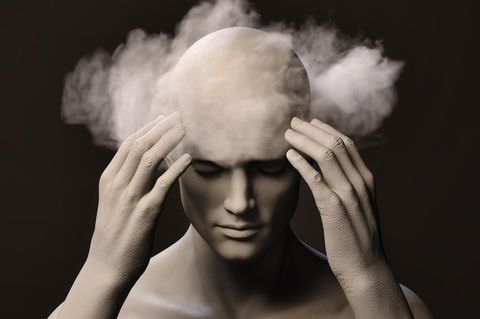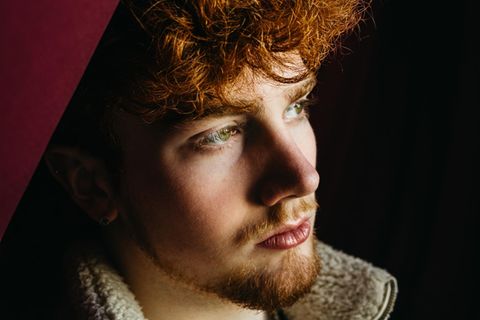Eine schwere Covid-19-Infektion hinterlässt Spuren. Viele Menschen haben danach monate- oder gar jahrelang mit Schwäche, Konzentrationsstörungen, Geruchsverlust zu kämpfen. Auch Schizophrenie könnte zu den potenziellen Folgeerkrankungen gehören, legt eine neue Studie nahe, die als Preprint erschienen ist.
Die Forschenden um Wanhong Zheng von der West Virginia University in den USA hatten ausgewählte klinische Daten von 650.000 Menschen in der Datenbank US National COVID Cohort Collaborative untersucht. Ungefähr ein Drittel der erfassten Personen war in der Vergangenheit moderat bis schwer oder gar tödlich an Covid-19 erkrankt. Ein Drittel wurde zum Zeitpunkt der Datenaufnahme negativ getestet, und ein Drittel litt an einer anderen schweren Lungenerkrankung. Niemand war psychisch vorerkrankt.
Je jünger die Patienten, desto größer das Risiko
Das Team schaute sich an, bei wie vielen Menschen in der Folge psychische Leiden auftraten. Das Ergebnis: Wer an Covid-19 erkrankt war, hatte drei Wochen später ein ungefähr 4,6 Mal höheres Risiko, eine Schizophrenie oder Psychose zu entwickeln, wie jemand, der negativ getestet worden war. Je jünger die Patienten, desto stärker war der Zusammenhang. Nach drei Monaten betrug der Unterschied immer noch 70 Prozent.
Bevor das Ergebnis endgültig feststeht, muss die Studie noch den wissenschaftlichen Begutachtungs- und Publikationsprozess durchlaufen. Im Zusammenhang mit Covid-19 ist es allerdings nicht unüblich, Studien schon vorab zu veröffentlichen.
Schizophrenie ist eine schwere seelische Erkrankung, bei der Wahnvorstellungen und Halluzinationen auftreten. Weltweit erleidet nach Schätzungen etwa 0,7 bis ein Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Leben eine schizophrene Psychose. Vor allem Menschen zwischen dem 18. und dem 35. Lebensjahr sind betroffen. Das Risiko ist also insgesamt nicht sehr hoch.
Hirnveränderungen sind auch im Zusammenhang mit Long Covid bekannt
Dass Viruserkrankungen, darunter auch die Grippe, ein Risikofaktor für den Ausbruch der Krankheit sein könnten, wurde schon länger vermutet. Die neue Studie hat den Zusammenhang nun statistisch weiter erhärtet. Und nicht zuletzt zeigt auch der bei vielen Long-Covid-Betroffenen auftretende "Brainfog", wie sehr eine Infektion mit Covid-19 das Denkorgan zumindest zeitweise belasten kann.
Eine mögliche Erklärung: Das Virus löst eine Entzündungsreaktion im Gehirn aus, die das Denken und Erleben beeinträchtigt, unter Fachleuten "Neuroinflammation" genannt. So findet man etwa bei Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen häufig veränderte Mikroglia – das sind spezielle Immunzellen im zentralen Nervensystem. Auch bei bipolarer Störung oder Depression gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zu neuroinflammatorischen Prozessen.
Bei Psychosen sofort zum Arzt
Ob tatsächlich Entzündungsprozesse für die vermehrten schizophrenen Psychosen nach einer Covid-19-Infektion verantwortlich sind, müssen allerdings künftige Studien zeigen. Wer bei sich oder bei Angehörigen Anzeichen für eine Psychose erkennt, sollte möglichst zeitnah medizinischen Rat suchen.
Im frühen Stadium ist die Krankheit häufig noch gut mit Medikamenten behandelbar, und Rückfälle lassen sich verhindern. Allerdings kann ein tiefes Misstrauen gegenüber Ärztinnen und Ärzten sowie fehlende Einsicht mitunter Teil des Krankheitsbildes sein. Spezielle Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen bieten Angehörigen in einem solchen Fall Hilfestellungen.