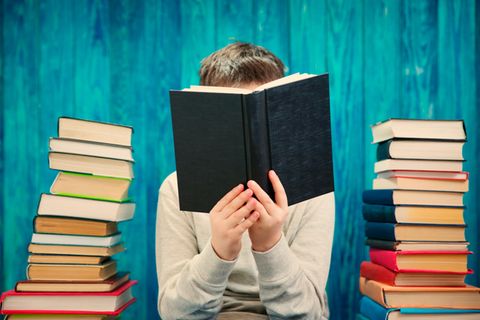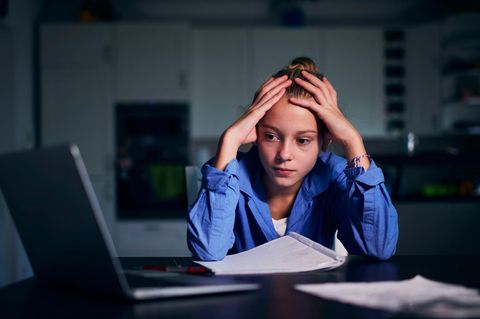Bei Schulkindern in Deutschland haben Befindlichkeiten wie Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen, Einschlafprobleme und Niedergeschlagenheit über die Jahre stark zugenommen. Das ist ein Ergebnis der Studie "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC), die im Fachblatt "Journal of Health Monitoring" veröffentlicht wurde. Demnach geben 42 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen an, dass sie unter vielfältigen psychosomatischen Beschwerden leiden – ein Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zur letzten Befragung in 2017/2018.
Die Wissenschaftlerin Dr. Franziska Reiß forscht am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zum seelischen Wohlbefinden von Heranwachsenden und hat die Ergebnisse der Erhebung mitausgewertet.
GEO: Warum klagen Schülerinnen und Schüler heute deutlich häufiger über psychosomatische Symptome?
Dr. Franziska Reiß: Der Erhebungszeitraum der jetzt veröffentlichten Studie fällt mit dem Ende der Covid-Pandemie zusammen. Wir gehen also davon aus, dass der Anstieg nicht zuletzt mit der schwierigen Situation zu tun hat, die Kinder und Jugendliche vor allem während der Lockdowns durchlebt haben. Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen, wenig Ablenkung in der Freizeit: All das hat die Gesundheit Heranwachsender stark beeinträchtigt – und wirkt bis heute nach. Inzwischen gibt jedes dritte Kind an, dass es sich durch das belastet fühlt, was in der Schule von ihm verlangt wird.
Und nun, nach der Pandemie, sind sie obendrein mit den Auswirkungen weiterer globaler Krisen konfrontiert.
Krieg in Europa, Krieg in Gaza, Klimawandel, Inflation: Die Schülerinnen und Schüler haben ein durchaus waches Auge für die gegenwärtigen Nachrichten aus aller Welt. Und sorgen sich entsprechend um die Zukunft, fühlen sich verunsichert. Im Grunde gab es für sie – wie für uns alle – nach den Anstrengungen der Pandemie kein richtiges Aufatmen. Die anhaltenden psychischen Belastungen äußern sich dann bei vielen eben irgendwann auch in körperlichen Symptomen wie Bauchschmerzen, schlechtem Schlaf oder Kopfschmerzen. Mädchen sind besonders betroffen: Jedes zweite berichtet über vielfältige psychosomatische Beschwerden, bei den Jungen ist es etwa jeder dritte.
Warum leiden Mädchen häufiger?
Länderübergreifend fällt auf, dass sie mit Belastungen anders umgehen, etwa sensibler auf Stress reagieren und im Vergleich zu Jungen auch häufiger gereizt sind, nervös und niedergeschlagen. Ein Erklärungsansatz ist, dass sie schwierige Situationen tendenziell anders bewältigen als Jungen. Mädchen richten Kummer eher nach innen, grübeln und geraten so in Sorgenspiralen, können schlechter einschlafen. Jungs hingegen verlagern psychische Konflikte eher nach außen, externalisieren sie und agieren dann auf der Verhaltensebene – sie überspielen, werden mitunter aggressiv. So findet ihr Frust leichter ein Ventil.
Was sollten Eltern tun, wenn ihr Kind vermehrt über Probleme klagt?
Wenn Beschwerden wie Bauch- oder Kopfschmerzen über längere Zeit anhalten, macht es durchaus Sinn, mithilfe eines Haus- oder Kinderarztes abzuklären, ob eine organische Ursache vorliegt oder nicht. Nur wenn dies nicht der Fall ist, sprechen wir von psychosomatischen Beschwerden.
Und denen begegnet man wie?
Es ist kein Fehler, Rücksprache mit Lehrerinnen und Lehrern zu halten, um herauszufinden, ob ein Kind Lernschwierigkeiten hat oder im Gegenteil: sich selbst zu viel Leistungsdruck auferlegt. Dann lässt sich mit konkreten Maßnahmen gegensteuern, etwa auch professioneller psychologischer Unterstützung. Wichtig ist aber vor allem, dass betroffene Kinder oder Jugendliche eine Ansprechperson haben, der sie ihre Belastungen offen anvertrauen können. Das können die Eltern sein. Vielleicht ist es aber auch eine Großmutter, ein Onkel oder eine andere Person aus dem Nahfeld.
Gerade Jugendliche sind gegenüber ihren Eltern häufig nicht besonders gesprächig. Was können Familien noch tun?
Wir stellen klar fest, dass Beschwerden in solchen Familien seltener auftreten, wo der Zusammenhalt stark ist, wo sich Heranwachsende aufgehoben und sicher fühlen. Schon einfache Regeln und Rituale können helfen, ein solches Umfeld zu schaffen. Etwa indem man feste Zeiten verabredet, in denen die Familie beisammen ist und Gelegenheit für persönlichen Austausch hat. Indem man Mahlzeiten gemeinsam einnimmt, Interesse an den Befindlichkeiten seiner Kinder zeigt, mit ihnen zum Beispiel bespricht, was sie in den sozialen Medien gesehen haben. Und nicht zuletzt, indem man klare Absprachen vereinbart, wann das Smartphone ausgeschaltet bleibt. So ergeben sich Möglichkeiten für andere Aktivitäten, zum Beispiel Bewegung im Freien.
Warum ist das wichtig?
In unseren Studien sehen wir klar, dass es einen starken Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und psychischer (und damit auch körperlicher) Gesundheit gibt. Es mag banal klingen, doch wenn Mütter und Väter es schaffen, dass Kinder nicht nur auf dem Rücksitz des Familienautos platznehmen, sondern regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs sind, draußen toben oder in einem Sportverein aktiv sind, haben sie einen ungemein wichtigen Beitrag zur Widerstandskraft ihrer Sprösslinge geleistet. Nicht zuletzt dazu, dass sie ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit entwickeln, also die Erfahrung machen, aus eigener Kraft Vorhaben verwirklichen zu können. Selbstwirksamkeit ist wohl eines der wichtigsten Schutzschilde gegen psychosomatische Leiden überhaupt.