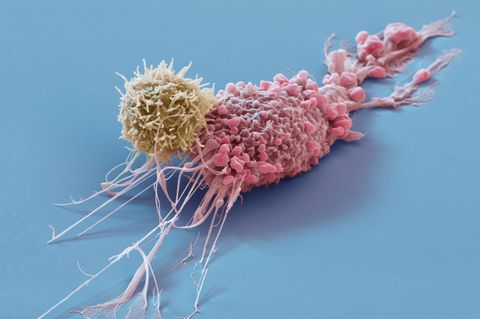Für alle Frauen ist es eine Lotterie, im schlimmsten Fall auf Leben und Tod: Im Laufe des Lebens erkrankt jede achte Frau hierzulande an Brustkrebs. Was wäre es für eine Chance, bei diesem Glücksspiel schummeln zu können. Besonders früh sagen zu können, ob ein Brustkrebs heranwächst – und diesen dann auszumerzen.
Was das Screening leisten kann
Das Mammographie-Screening ermöglicht das in vielen Fällen: Die Vorsorgeuntersuchung wird Frauen zwischen 50 und 75 Jahren alle zwei Jahre empfohlen, die Kosten werden von den Kassen übernommen. Dabei wird das Brustgewebe mit Röntgenstrahlen untersucht, um Veränderungen sichtbar zu machen, die sich weder ertasten lassen noch anderweitig bemerkbar machen. Auf den Aufnahmen können Medizinerinnen und Mediziner selbst kleinste Gewebeveränderungen erkennen – oft lange, bevor ein Tumor Beschwerden verursacht oder spürbar wird. Die Untersuchung dauert inklusive Vorgespräch nur 10 bis 15 Minuten. Doch diese Chance nutzt in Deutschland nur jede zweite Frau – 50 Prozent nehmen nicht am Screening teil. Woran liegt das?
„Ein Teil dieser Zurückhaltung ist historisch bedingt. Bei der Einführung des Mammographie-Screenings in Deutschland ab dem Jahr 2005 lagen ausschließlich Studiendaten anderer Länder aus den 1970er- und 1980er-Jahren vor. In der Zwischenzeit hatte es aber Fortschritte in der Brustkrebsbehandlung gegeben. Und deshalb fragte man sich, ob das Screening wirklich sinnvoll sei, ob mögliche Risiken seinen Nutzen überstiegen“, sagt die Medizinerin Dr. Marianne Röbl-Mathieu, die sich nicht nur in der Brustkrebsprävention engagiert, sondern auch Mitglied der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut ist. „In Übereinstimmung mit internationalen Daten konnte inzwischen auch für das deutsche Screening-Programm der große Nutzen der Mammographie nachgewiesen werden. Etwa jeder vierte Brustkrebstodesfall lässt sich durch regelmäßige Teilnahme am Screening verhindern“, so Röbl-Mathieu, die seit mehr als 30 Jahren als niedergelassene Gynäkologin in München praktiziert.
Neue Daten, klarer Nutzen
Zu diesem Ergebnis kommt auch eine groß angelegte Auswertung im Auftrag des Bundesamt für Strahlenschutz. In der ZEBra-Studie werteten Forschende bundesweite Krebsregisterdaten aus und verglichen Frauen, die am organisierten Mammographie-Screening teilgenommen hatten, mit Frauen derselben Altersgruppe ohne Screening-Teilnahme.1 Das Ergebnis: Bei den Teilnehmerinnen war die Brustkrebs-Sterblichkeit um 20 bis 30 Prozent geringer.
Wegen der hohen Wirksamkeit wurde die obere Altersgrenze für das empfohlene Mammographie-Screening erst im Jahr 2024 von 70 auf 75 Jahre erhöht. „Ich gehe davon aus, dass das Anspruchsalter auch an der Untergrenze bald gesenkt werden wird, zunächst auf 45 Jahre“, sagt Röbl-Mathieu.
Doch es gilt eben auch: Alles, was wirkt, kann Nebenwirkungen haben. Das trifft selbst für eine Vorsorgeuntersuchung wie das Mammographie-Screening zu. Da ist zunächst die Strahlenbelastung: Sie entsteht, weil bei der Mammographie Röntgenstrahlen eingesetzt werden, um das Brustgewebe sichtbar zu machen. Allerdings ist diese Belastung vergleichsweise gering: Bei einer Mammographie ist der Körper der der Strahlendosis von zwei bis vier Transatlantikflügen ausgesetzt – bei einer Untersuchung, die nur alle zwei Jahre empfohlen wird. „Das Risiko ist in der Praxis zu vernachlässigen. Vor allem angesichts dessen, wie viele Brustkrebserkrankungen dank des Screenings frühzeitig entdeckt und praktisch geheilt werden können“, sagt Röbl-Mathieu.
Dennoch: Für manche Frauen ist nicht entscheidend, wie klein ein Risiko statistisch ist – sondern, dass es überhaupt existiert. Die Angst vor der Strahlendosis – und sei sie noch so gering – dürfte dazu beitragen, dass ein Teil der Frauen dem Mammographie-Screening fernbleibt.
Fehlalarm: Die Kehrseite der Früherkennung
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Angst vor falsch-positiven Ergebnissen: Gemeint sind Befunde, bei denen die Mammographie einen verdächtigen Bereich zeigt, der sich später nicht als gefährlicher Brustkrebs entpuppt. Manchmal werden Gewebeveränderungen entdeckt – etwa sehr langsam wachsende Zellveränderungen, von denen viele im Laufe des Lebens vermutlich nie Probleme gemacht hätten.
Um abzuklären, ob von einem solchen Befund eine Gefahr ausgeht, sind weitere Untersuchungen nötig. In manchen Fällen gehört dazu auch eine Biopsie, die Entnahme einer Gewebeprobe. „Solche Eingriffe sind heute Routine. Aber wie bei jedem medizinischen Eingriff, sind damit auch Risiken für Komplikationen verbunden wie Schmerzen, Blutergüsse, selten auch Infektionen. Und danach hat man Klarheit. Ich würde jedenfalls wissen wollen, um welche Art von Gewebeveränderung es sich handelt. Am Ende geht es aber immer um eine persönliche Entscheidung der betroffenen Frau, in der Regel nach ausführlicher Beratung“, sagt Marianne Röbl-Mathieu.
Trotz Strahlenbelastung und möglichen, zunächst beunruhigenden Ergebnissen: Letztlich biete die Mammographie den Frauen große Chancen, betont Röbl-Mathieu: „Das Screening hilft, den Brustkrebs möglichst früh zu erkennen sowie schonend und wirksam zu behandeln. Und wenn nichts gefunden wird, sind die Patientinnen beruhigt.“ Bei rationaler Betrachtung ist Angst also kein Grund, nicht zur Untersuchung zu gehen. Aber Angst ist eben auch nicht rational.
Auch die direkte Ansprache in den gynäkologischen Praxen spielt eine wichtige Rolle. Zwar bekommen Frauen von den Krankenkassen im entsprechenden Alter alle zwei Jahre eine schriftliche Einladung zum Screening – aber so etwas landet auch schnell ungelesen im Papierkorb. „Dieses förmliche Schreiben wirkt auf manche Frauen befremdlich. Deshalb erscheint es mir sehr sinnvoll, wenn Frauenärzte und -ärztinnen anspruchsberechtigte Frauen bereits im Vorfeld gezielt auf diese Einladung aufmerksam machen und über die Hintergründe aufklären“, so Röbl-Mathieu. Hier sei noch Luft nach oben, gerade weil das Wissen über das Mammographie-Screening, seinen Nutzen und die Risiken, in Teilen der Bevölkerung überraschend gering sei.
Viele Frauen unterschätzen das Risiko zu erkranken
Angst und fehlendes Wissen: zwei wichtige Gründe, aus denen nur 50 Prozent der Frauen das Screening wahrnehmen. Ein weiterer Faktor ist laut Röbl-Mathieu die Unterschätzung des Risikos: „Viele Frauen, die sich gesund fühlen, körperlich fit sind und keine Beschwerden haben, gehen davon aus, dass es sie schon nicht treffen wird“, so Röbl-Mathieu. Zwar sei positives Denken gut und richtig – aber sich darauf zu verlassen, sei riskant. Denn das Risiko für Brustkrebs lässt sich nur begrenzt durch den Lebensstil beeinflussen, am ehesten durch Verzicht auf Alkohol, sondern hängt auch von Faktoren wie familiärer Vorbelastung oder der Dichte des Brustdrüsengewebes ab. Die Diagnose Brustkrebs kann jede Frau treffen.
Doch nicht immer wird im Leben so gehandelt, dass Risiken konsequent minimiert werden. Das ist beim Brustkrebs-Screening nicht anders als bei anderen Gesundheitsentscheidungen – man kann es durchaus mit dem Rauchen vergleichen. Der Staat kann regulieren, Krankenkassen können informieren und erinnern, Einladungen verschicken, Broschüren beilegen. All das kann die Entscheidung für die Vorsorge aber nicht erzwingen.
Das Brustkrebs-Screening muss man wollen. Es reicht nicht, etwas zu lassen oder zu vermeiden – man muss einen Termin vereinbaren, sich der Untersuchung stellen. Für manche Frauen ist das eine größere Hürde, als es Mediziner und Medizinerinnen rational erwarten würden. Dabei sind die praktischen Barrieren objektiv niedrig: Wer es schafft, einmal im Jahr zur gynäkologischen Kontrolle zu gehen oder andere Vorsorgeangebote wahrzunehmen, kann in der Regel auch ein Mammographie-Screening organisieren. Am Ende bleibt es dennoch eine Abwägung: Die Entscheidung für oder gegen das Brustkrebs-Screening muss jede Frau selbst treffen.