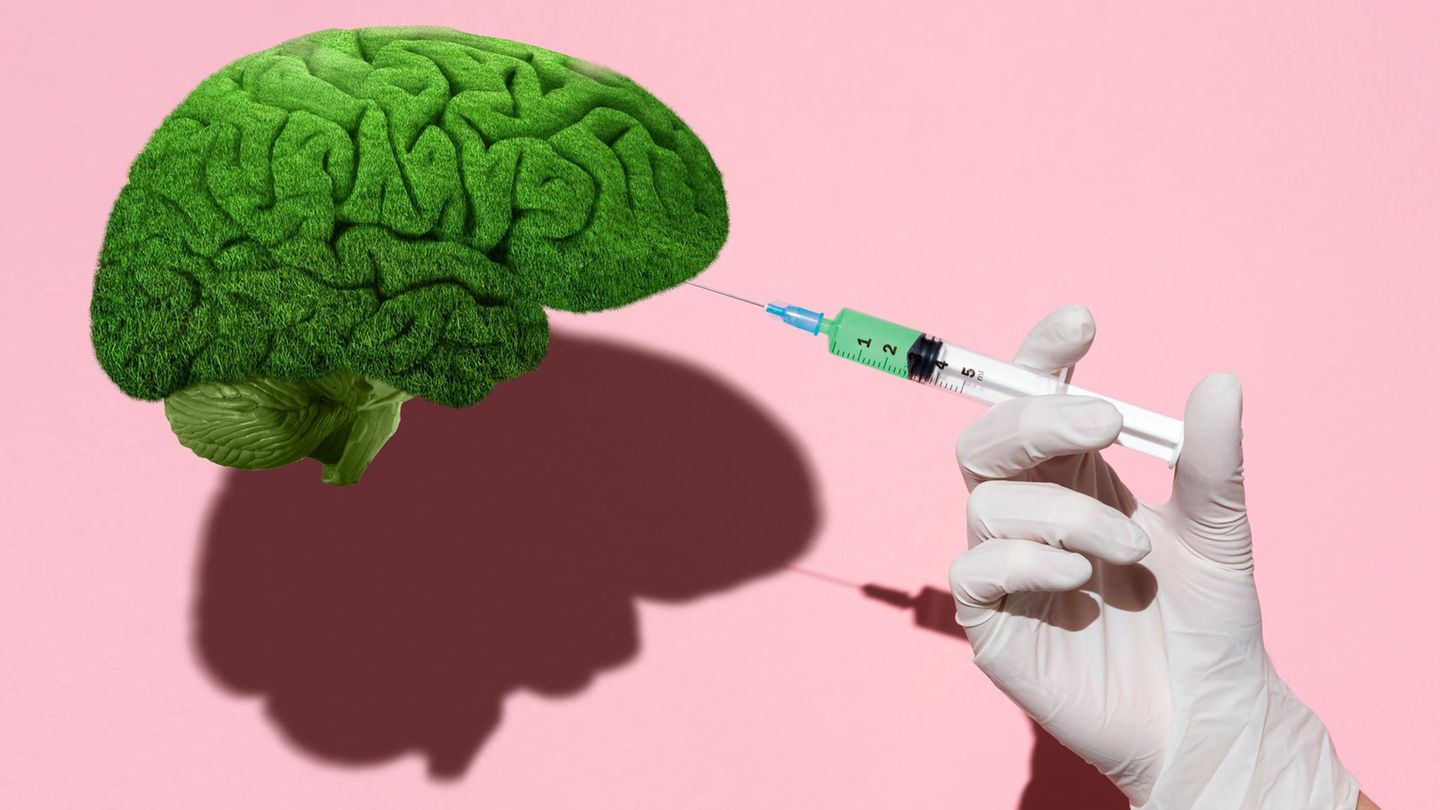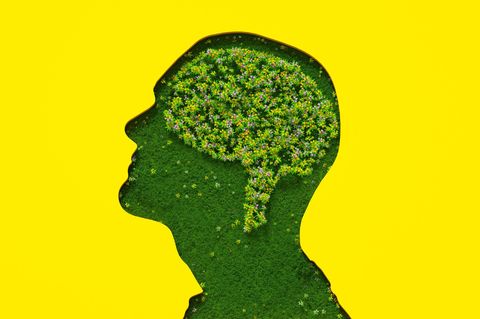Der Wirkstoff Semaglutid wird bislang gegen Diabetes Typ 2 und Übergewicht eingesetzt. Studie um Studie zeigen, dass er auch darüber hinaus positive Effekte entfalten könnte, zum Beispiel auf das Herz-Kreislauf-System – und sogar auf die Entstehung einer Demenz. Und zwar stärker, als man das nach jetzigem Kenntnisstand erwarten würde.
Zu diesem Schluss kommt eine medizinische Forschungsgruppe aus Cleveland um Rong Xu, deren Studie im Fachmagazin "Journal of Alzheimer’s Disease" erschienen ist. Das Team hat die medizinischen Daten aus drei Jahren von rund 1,7 Millionen Diabetespatientinnen und -patienten in den USA ausgewertet. Diese hatten entweder Semaglutid oder ein anderes Medikament erhalten, zum Beispiel Insulin, Metformin oder einen Vorgängerwirkstoff von Semaglutid.
Im Vergleich zu einer Insulinbehandlung verringerte sich das Demenzrisiko um fast 50 Prozent
Mithilfe statistischer Methoden und anhand der Beobachtungsdaten stellten die Forschenden nachträglich eine Art randomisierte Studie nach. Die Ergebnisse ihrer Analyse fielen überraschend klar aus: Im Vergleich zu Insulin war die Wahrscheinlichkeit für eine Demenzdiagnose mit Semaglutid um 46 Prozent geringer, im Vergleich zu Metformin um 33 Prozent und im Vergleich mit dem Semaglutidvorgänger (GLP-1RAs) um 20 Prozent. Am größten war der Effekt bei Frauen und bei Menschen, die zusätzlich übergewichtig waren.
Allerdings gilt das Ergebnis nicht für alle Demenzarten gleichermaßen. Bei vaskulärer Demenz, die aus Gefäßschäden resultiert, ist der Zusammenhang am stärksten. Ebenso bei der klassischen Alzheimer-Demenz, wie eine Vorgängerstudie bereits im Oktober gezeigt hatte.
Bei der Lewy-Körper-Demenz, die größtenteils erblich bedingt ist, trat keine Reduktion ein. Bei der seltenen frontotemporalen Demenz, die schon in jüngeren Jahren einsetzt, häuften sich die Diagnosen sogar. Das mag damit zusammenhängen, dass Semaglutid das Risiko für Schilddrüsenleiden erhöht, die wiederum ein Risikofaktor für frontotemporale Demenz sind, schreiben die Forschenden. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Behandlung mit Semaglutid ärztlich abzustimmen und nichts auf eigene Faust einzunehmen.
Zu beachten ist auch: Die Zahlen beziehen sich auf das relative Risiko. Anders gesagt: Alle untersuchten Medikamente senken das Demenzrisiko vermutlich um einen bestimmten Wert. Und dieser wird von Semaglutid noch einmal übertroffen. Im Falle von Insulin sogar um fast 50 Prozent. Welchen Einfluss Semaglutid auf das absolute Demenzrisiko hat, wurde in der vorliegenden Studie hingegen nicht untersucht. Dafür hätte es eine Kontrollgruppe gebraucht, die keinerlei Diabetes-Medikamente erhält.
Semaglutid wirkt auf mehrere Risikofaktoren der Demenz ein
Nach heutigem Kenntnisstand trägt Diabetes ungefähr zwei Prozent zum Demenzrisiko bei. Daneben gibt es noch weitere Risikofaktoren, die teils ebenfalls behandelbar sind. Je nach Schätzung ließen sich 45 Prozent der Demenzfälle verhindern, wenn man alle Risikofaktoren ausschaltet. Diese sind nach jetzigem Wissen:
- Diabetes
- Übergewicht
- Bluthochdruck
- Rauchen
- Depression
- Bewegungsmangel
- exzessiver Alkoholkonsum
- Hirntraumata
- geringe Bildung
- Luftverschmutzung
- soziale Isolation
- hoher LDL-Cholesterinspiegel
Jeder dieser Faktoren trägt ein bis sieben Prozent zum Demenzrisko bei. Mittel gegen Diabetes setzen nach bisheriger Erkenntnis bei bis zu zwei dieser Faktoren an: Diabetes und Übergewicht.
Doch wie ist zu erklären, dass Semaglutid das Demenzrisiko so viel stärker senkt als vergleichbare Medikamente?
Das Team um Xu schreibt, dass Semaglutid Diabetes in vielen Fällen besser reguliere als seine Vorgänger oder Alternativen wie Insulin und Metformin. Das allein könne die große Differenz der Demenzfälle aber nicht erklären. Die Forschenden vermuten vielmehr, dass Semaglutid an weiteren, noch unentdeckten Stellschrauben für das Demenzrisiko dreht.
So könnte der Wirkstoff auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegenwirken, die vermittels hohem Blutdruck und LDL-Cholesterin wesentlich zum Demenzrisiko beitragen.
Darüber hinaus gibt es Hinweise aus Studien, dass Semaglutid nicht nur Essgelüste zügelt, sondern auch den Appetit auf Alkohol oder Zigaretten. Und nicht zuletzt geraten Entzündungen und Autoimmunreaktionen immer mehr ins Visier der Forschung. Auch sie scheinen eine noch nicht ganz verstandene Rolle bei der Entstehung von Demenz zu spielen. Womöglich wirkt Semaglutid auf das Immunsystem und verringert auf diese Weise Gefäßentzündungen im Gehirn oder das Absterben von Nervenzellen.
Eignet sich Semaglutid auch für Nichtdiabetiker zur Demenzprophylaxe?
Allerdings deckt die vorliegende Untersuchung nur einen Zeitraum von drei Jahren ab – schließlich ist Semaglutid noch nicht lange am Markt. Möglicherweise flacht der Effekt mit zunehmender Anwendungsdauer irgendwann ab oder wird sogar größer.
Unklar ist auch, ab welchem Zeitpunkt man am besten mit der Behandlung beginnt. Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass die Wirkung umso größer zu sein scheint, je jünger die Patient*innen sind (wobei mit "jung" ein Durchschnittalter um die 50 gemeint ist).
Was bedeuten diese Erkenntnisse für Menschen, die weder unter Diabetes noch unter Übergewicht leiden, aber beispielsweise ein familiäres Risiko für Demenz tragen? Könnte Semaglutid eines Tages auch für sie als Prophylaxe in Betracht kommen?
Was ist Semaglutid?
Semaglutid ist im Diabetesmedikament Wegovy und in der Abnehmspritze Ozempic als Wirkstoff enthalten. Semaglutid ist ein Signalbotenstoff, genauer ein GLP-1R-Molekül. Es imitiert die Wirkung des körpereigenen Hormons GLP-1, das der Körper nach dem Essen ausschüttet. Dazu dockt es an bestimmte Rezeptoren an und vermittelt das Gefühl von Sättigung. Zudem unterstützt es die Blutzuckerregulierung bei Diabetes Typ 2, indem es die Insulinproduktion ankurbelt.
"Wir glauben, dass Semaglutid bei Menschen ohne Diabetes oder Fettleibigkeit einen Nutzen bei der Demenzprävention haben könnte", erklärt Xu, "es braucht randomisierte klinische Studien, die das untersuchen." Und mit Tirzepatide steht bereits das nächste Mittel in den Startlöchern, das ersten Studien zufolge direkt im Gehirn wirken und dort noch bessere Effekt erzielen soll.
Ganz verhindern lassen wird sich Demenz in den meisten Fällen auf absehbare Zeit jedoch nicht. Es geht vielmehr darum, den Symptombeginn weit hinauszuschieben, um den Betroffenen möglichst lange Lebensqualität und Selbstständigkeit zu bewahren. Deshalb ringen Forscherinnen und Ärzte bei der Prophylaxe um jedes Prozent. Dabei setzen sie nicht allein auf Medikamente, sondern auch auf Hilfe zur Selbsthilfe: allen voran Sport, gesunde Ernährung und ein reiches Sozialleben.