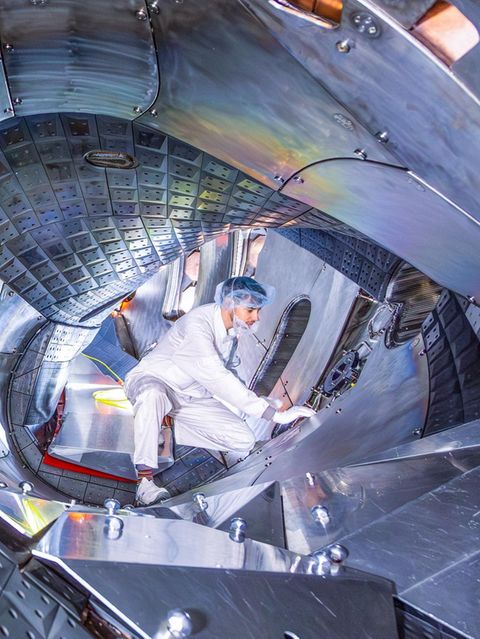GEO.de: Seit dem Ausbruch des Corona-Virus ist in Deutschland vor allem ein Wort omnipräsent: Solidarität. Es komme jetzt darauf an, solidarisch zu handeln – kommentieren die Medien, fordern die Virologen, appelliert die Kanzlerin in ihrer Fernsehansprache. Doch was ist das überhaupt, Solidarität?
Sighard Neckel: Aus soziologischer Sicht ist mit Solidarität immer eine bestimmte Vorstellung davon gemeint, was wir uns gegenseitig an Unterstützung und Hilfe schuldig sind. Beim solidarischen Handeln ist man aufgefordert, von seinem Eigeninteresse abzusehen, auf eine Belohnung zu verzichten und auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Hier liegt der Unterschied zwischen Kooperation und Solidarität: Wer mit der Kalkulation auf einen eigenen Vorteil anderen hilft, handelt vielleicht auch gut und richtig, kann aber nicht für sich in Anspruch nehmen, solidarisch zu sein. Für solidarisches Handeln sollte ein erwartbarer Nutzen keine Rolle spielen.
Solidarität ist also ein rein altruistisches Konzept?
Nicht ganz. Zu einer Hilfeleistung unter Inkaufnahme eigener Nachteile ist man meist nur bereit, wenn man erwarten kann, dass man dieselbe Unterstützung erfahren wird, wenn man selbst auf Andere angewiesen ist. Solidarisches Handeln, das vom Eigennutz absieht, basiert also auf Vertrauen – dem Vertrauen auf Wechselseitigkeit.
Gegenüber Menschen, die wir kennen, ist das einfach nachzuvollziehen: Innerhalb unserer Familien- oder Freundeskreise nehmen wir ständig den eigenen Nachteil in Kauf. Warum aber sollte ich mich mit Fremden solidarisieren?
Émile Durkheim, einer der Urväter der Soziologie, hat zwischen zwei Formen von Solidarität unterschieden, die uns das auch heute noch einsichtig machen können: die mechanische und die organische Solidarität. Die mechanische Solidarität beruht auf Ähnlichkeit – sie bezieht sich rein auf die eigene Gruppe, wie auch immer sie verstanden wird. Das kann die Familie, der Clan, das eigene Volk oder die eigene Klasse sein. Innerhalb dieser Gruppe ist man solidarisch, weil die Anderen einem ähnlich sind. Jeder, der einem nicht ähnlich ist – also der Fremde – hat keinen Anspruch auf Solidarität. Im Gegenteil: Außenstehende werden als Personen betrachtet, denen gegenüber man auch unmoralisch handeln darf. Innerhalb der eigenen Gruppe herrscht Solidarität; außerhalb darf unsolidarisch gehandelt werden.
Organische Solidarität wäre folglich das Gegenteil? Sie unterscheidet nicht zwischen Innen und Außen?
Durkheim wählte den Begriff organisch, weil diese Solidarität nicht auf bestimmten Gruppenzugehörigkeiten, sondern auf wechselseitiger Angewiesenheit beruht. Wie in einem Körper die verschiedenen Organe aufeinander angewiesen sind, so kann in einer modernen arbeitsteiligen Gesellschaft das eine soziale Segment nicht ohne das andere bestehen. Hier ist man nicht solidarisch, weil man sich ähnlich ist, sondern weil man zusammenarbeiten muss.
Ich muss also nur solidarisch mit Menschen sein, auf die ich auch angewiesen bin?
Im Zeitalter universal geltender Menschenrechte gehen wir darüber hinaus und verbinden mit Solidarität nicht nur ein funktionales Interesse, sondern auch einen normativen Anspruch: Wir sollen solidarisch sein gegenüber allen, die uns gleichgestellt sind, da sie die gleichen grundlegenden Rechte haben wie wir.
Warum endet Solidarität dann trotzdem meist an Grenzen und Schlagbäumen?
Wie gesagt, Solidarität basiert auf dem Vertrauen auf Wechselseitigkeit. Je größer der Bezugskreis ist, in dem ich solidarisch sein soll, umso schwieriger wird es, dieses Vertrauen aufrecht zu erhalten. Dies zu schaffen, ist die Herausforderung unserer Gegenwart: Wie können wir ein weltweit gespanntes Netz der Solidarität entwickeln, in dem ich mich gegenüber weit entfernten Menschen zur Solidarität verpflichtet fühle, diese aber auch mir gegenüber? Wobei Stärkere zur Solidarität viel eher angehalten sind als diejenigen, die der Unterstützung bedürfen.
Ich gebe die Frage zurück: Wie geht das? Braucht es Regeln, Gesetze?
Auch wenn Solidarität heute den Anspruch hat, universal zu sein: Faktisch, glaube ich, lässt sie sich nur in einer gestaffelten Form realisieren, die jeweils unseren erweiterten Nahbereich erfasst. Auf Europa bezogen wäre das etwa der nordafrikanische Raum. Würde diese gestaffelte Form von Solidarität überall auf der Welt gelten, würde niemand aus ihrem Netz herausfallen. Sie wäre aber nicht so weit überdehnt, dass es kein Zutrauen in Wechselseitigkeit mehr gibt.
Abgesehen von Grenzen und Gruppenzugehörigkeiten: Als Erzfeind der Solidarität wird heute oft der Neoliberalismus herangezogen, dessen liberale Wirtschaftspolitik auf Eigeninteresse jedes Einzelnen gepolt ist und der keinen Raum für solidarisches Handeln vorsieht – so der Kanon der Kritiker. Stimmt das, hat uns die neoliberale Ordnung egoistischer gemacht?
Grundsätzlich schließe ich mich dieser Auffassung an. Der Grundgedanke des Neoliberalismus und überhaupt der klassischen ökonomischen Theorie folgt der Maxime: Dem gesellschaftlichen Wohl ist am besten gedient, wenn jeder Einzelne versucht, seinen maximalen Nutzen zu erzielen. Dies steht dem Solidaritätsgedanken entgegen, der einfordert, auch eigene Nachteile in Kauf zu nehmen, um andere zu unterstützen. Gegen diese Grundüberzeugung sind Neoliberale seit Ende der 1970er Jahre angetreten, als sie den modernen Sozialstaat als Institution eines verschwenderischen Mitgefühls angegriffen haben.
Aber: In einer utopischen Welt mit perfekter Verteilung und einem florierenden, sich selbst regulierenden Markt – wäre Solidarität da nicht tatsächlich überflüssig?
Nein. Dieses Gedankenspiel basiert auf der Vorstellung einer perfekten Organisation, die alles weiß und alles regelt. Dies kann es nicht geben, weil wir zum Beispiel den Zufall nicht ausschließen können. Und auch nicht die Anfälligkeit von Gesellschaften. Der Klimawandel etwa zeigt uns, dass wir nicht in einer autarken menschlichen Welt leben, sondern ein Teil des Erdsystems sind. Damit sind auch alle Unwägbarkeiten der Natur Teil unserer Welt. Eine perfekte Organisation der Gesellschaft durch den Markt kann es auch deswegen nicht geben, weil nie alle dafür relevanten Informationen verfügbar sind und wir sie auch gar nicht verarbeiten könnten. Das wäre eine Gottesvorstellung, die wir uns besser für den Glauben aufheben sollten.
Was macht das mit der Solidarität einer Gesellschaft, wenn solche Unwägbarkeiten eintreten, wenn Naturkatastrophen Landstriche befallen, Seuchen Städte heimsuchen?
In der Soziologie gibt es eine ganze Teildisziplin, die sich damit befasst: die Katastrophensoziologie. Da gibt es Studien etwa zu den Auswirkungen des Hurricane Katrina, zu Reaktorunfällen wie in Tschernobyl oder Fukushima, zu Erdbeben, Epidemien oder Flutkatastrophen. Dadurch weiß man zum Beispiel, dass eine Katastrophe wie ein Erdbeben nicht zu vergleichen ist mit einer Seuchenepidemie.
Warum nicht?
Weil das Handeln von Menschen in solchen Katastrophen immer davon abhängt, wovon die Gefahren ausgehen. Bei einem Erdbeben geht die Gefahr nicht von anderen Menschen aus, sondern von tektonischen Verschiebungen, denen man gemeinsam ausgeliefert ist. Bei einer Epidemie ist das anders: Einer hat vor dem anderen Angst. Solidarisches Handeln muss diese Angst erst einmal überwinden, bevor es wirksam werden kann. In solchen Situationen sind Menschen extrem anfällig dafür, allein auf das eigene Überleben zu schauen. Sündenböcke werden gesucht, um Schuldige für die Katastrophe zu finden. Auch US-Präsident Trump spricht davon, dass Covid-19 ein „chinesisches Virus“ sei. Nur schadet eine solche Atmosphäre der Feindseligkeit einer Gesellschaft deutlich mehr als eine solidarische Haltung. Ein bekanntes historisches Beispiel dafür ist die Reaktion auf die Spanische Grippe in den USA: Während es in Philadelphia keine individuellen Einschränkungen gab, wurden in St. Louis die Warnungen vor der Epidemie rasch in Maßnahmen des gegenseitigen Schutzes umgesetzt. Die Opferzahlen in Philadelphia waren um ein Vielfaches höher als in St. Louis. In solchen Situationen ist das eigene Wohl am besten gesichert, wenn eben nicht jeder allein auf sich selbst schaut, sondern möglichst viele untereinander solidarisch sind.
Nun sind menschliche Kontakte während der Corona-Krise aber nun mal potenziell gefährlich. Wie kann ich trotzdem solidarisch handeln?
In unserer Gesellschaft ist sozialer Kontakt ja nicht gleichbedeutend mit körperlicher Nähe, da haben wir heute viele andere Möglichkeiten. Und in der jetzigen Situation heißt Solidarität eben das Vermeiden von körperlichen Kontakten. Ich handele solidarisch, wenn ich zuhause bleibe. Aber auch hierfür braucht man das Vertrauen auf Wechselseitigkeit: Wenn ich zuhause bleibe, möchte ich nicht, dass ein paar Straßen weiter Corona-Partys gefeiert werden. Nun können Sie nicht an jede Straßenecke einen Polizisten stellen, um das zu überwachen. Daher braucht Solidarität das Vertrauen, dass auch andere solche Maßnahmen einhalten werden.