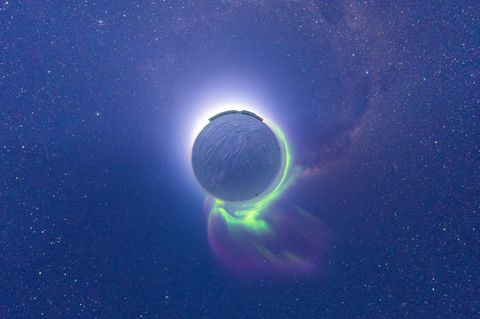Säuglinge unterscheiden sich voneinander, wenn sie brüllen: Je nach der Sprache der Eltern klingt das Weinen anders. Das haben die Anthropologin Kathleen Wermke und ihr Team von der Universitätsklinik Würzburg nachgewiesen.
Dieser Artikel ist in P.M. Schneller Schlau erschienen.
Weitere Artikel, Videos und Podcasts von P.M. finden Sie unter www.pm-wissen.com
Die Neugeborenen formulieren beim Schreien zwar keine Wörter, übernehmen aber in ihren Äußerungen die für ihre Muttersprache typische Melodie. Diese auch Prosodie genannte Sprachmelodie entsteht aus einer charakteristischen Kombination von Intonation und Rhythmus. Deutsche etwa betonen eher den Anfang eines Wortes, so wie bei "Mama" oder "Papa". Ruft ein französisches Kind nach "maman", hebt sich seine Stimme dagegen bei der zweiten Silbe, da die Betonung im Französischen meist am Ende eines Wortes liegt. Gleiches hört man dem Schreien von Säuglingen an. Das zeigten schon frühere Studien des Würzburger Teams, als es das Weinen französischer und deutscher Babys aufzeichnete und Frequenz, Melodie sowie Tonhöhe analysierte.
Schon in den ersten sechs Monaten nimmt die Komplexität der Schreilaute von Babys zu
Für eine neue Studie untersuchte die Gruppe nun mit Forschenden aus den USA und Neuseeland 67 500 Schreilaute von 277 Babys. Ergebnis: Schon in den ersten sechs Lebensmonaten nimmt die Komplexität der Schreie zu – hört man genau hin, wird das Weinen also melodischer, erschallt zunehmend in mehrbögigen statt in einfachen Melodien. "Bereits am Ende des ersten Lebensmonats weist das Schrei-Repertoire bei mehr als der Hälfte der untersuchten Babys eine komplexe Melodie auf", sagt Wermke.
Dass die Säuglinge so rasch lernen, hängt mit dem schnellen Wachstum des Gehirns in den ersten Monaten zusammen. Aber auch damit, vermuten die Forschenden, dass sie schon im Mutterleib Melodie und Rhythmus der gehörten Sprache verinnerlichen. Die Forschenden hoffen, mithilfe der neuen Erkenntnisse Sprachstörungen früher erkennen und besser therapieren zu können.