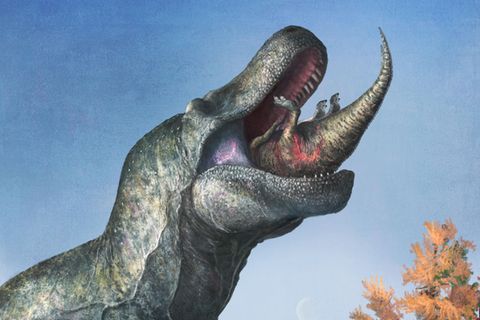Am Ende der Kreidezeit veränderte sich das Antlitz der Erde schlagartig. Ein etwa 15 Kilometer großer Gesteinsbrocken stürzte vom Himmel und schlug mit unvorstellbarer Wucht auf der mexikanischen Halbinsel Yukatan ein. Der Meteoriteneinschlag ließ Gestein verdampfen, schleuderte Staub, Geröll und geschmolzene Mineralien hoch in die Atmosphäre und sandte Schockwellen durch den gesamten Planeten. Stürme tobten, Flutwellen türmten sich auf, Waldbrände wüteten rund um den Globus.
Für das Massensterben jedoch, dem drei Viertel aller Arten erlagen – darunter alle Dinosaurier, die das Land und die Meere bevölkert hatten – war das Inferno direkt nach dem Einschlag vermutlich nicht verantwortlich. Vielmehr stehen umherschwirrende Schwefel- und Rußpartikel im Verdacht, den Himmel verdunkelt und damit einen globalen Winter ausgelöst zu haben. Die Hypothese: Weil weniger Sonnenlicht die Erdoberfläche erreichte, fielen weltweit die Temperaturen. Kälte und Dämmerlicht bremsten auch die Photosynthese aus. Ohne Pflanzen und Algen, die Licht in Biomasse umwandelten, brachen die Nahrungsketten zusammen. Es regierte der Hunger.
Silikatpartikel in der Atmosphäre waren Gift für das Pflanzenwachstum
Doch die Mechanismen, die zum anschließenden Massensterben führten, sind nach wie vor nicht im Detail verstanden. Forschende um Cem Berk Senel von der Königlichen Sternwarte in Belgien haben sich nun die Rolle eines weiteren, bisher weitgehend übersehenen Übeltäters angeschaut.
In 66 Millionen Jahre alten, gut erhaltenen Ablagerungen im US-Bundesstaat North Dakota untersuchten sie Rückstände von Schwefelteilchen, Ruß aus Bränden sowie von feinen Staubkörnchen aus Silikaten, die beim Einschlag pulverisiert worden waren. Dabei zeigte sich, dass Silikatpartikel mit einem Durchmesser von 0,8 bis acht Mikrometern in größerer Menge vorhanden waren als bisher vermutet.
In einer anschließenden Klimasimulation betrachtete das Team die Auswirkungen von Ruß, Schwefel und Staub, sowohl getrennt als auch gemeinsam. Dazu schätzte es, dass der Einschlag insgesamt zwei Billionen Tonnen der kleinen Silikatpartikel in der Atmosphäre geschleudert hatte. Sie verweilten dort für bis zu 15 Jahre. Um den ganzen Erdball verteilt trugen sie dazu bei, dass die Temperaturen um bis zu 15 Grad Celsius fielen und erst nach 20 Jahren wieder das vorherige Niveau erreichten. Insbesondere verlängerten sie die Phase, in der die Photosynthese weitgehend zum Erliegen kam, von weniger als einem Jahr (Ruß und Schwefel) auf 1,7 Jahre.
„Gruppen von Lebewesen, die nicht daran angepasst waren, die dunklen, kalten und nahrungsarmen Bedingungen fast zwei Jahre lang zu überleben, wären [in diesem Szenario] einem massiven Aussterben zum Opfer gefallen“, schreiben die Autor*innen in der Fachzeitschrift „Nature Geoscience“. Dies stimme mit den paläontologischen Daten überein: Überlebt hätten vor allem solche Arten, in eine Ruhephase eintreten konnten – etwa, indem sie Samen oder Zysten bildeten oder in Erdlöchern überwinterten. Im Vorteil waren außerdem Spezies, die nicht von einer bestimmten Nahrungsquelle abhängig waren. Unter den Dinosauriern überdauerten lediglich die Vorfahren der Vögel – alle anderen raffte es dahin.
Um die Ecke gefragt
Wem verdankt der Saturn seine Ringe? Wer macht Wölfe zu Rudelführern? Und wann kommen die ersten Autos mit Solarzellen?
Jeden Montag stellen die wir eine etwas andere Frage und liefern eine lehrreiche Antwort.