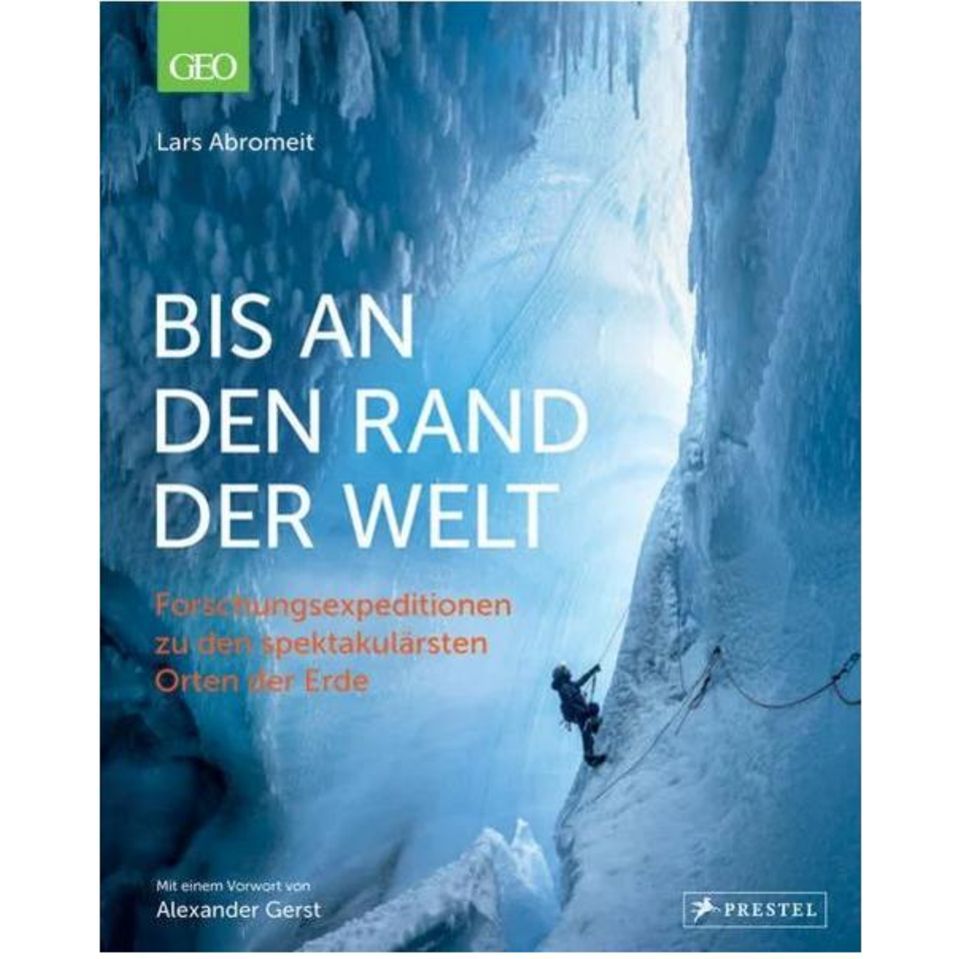Den. Bergstiefel. Anziehen. Zunächst den rechten. Dann Luftholen. Pausieren. Die Schnürsenkel binden. Die Steigeisen anlegen. Und wieder um Atem ringen.Quälend langsam jede Bewegung. Selbst die einfachsten Dinge kosteten Kraft, Überwindung, Konzentration. Wir waren am Ende – und endlich am Ziel: angekommen auf einem Gletscherhang im Himalaja, auf 7000 Meter Höhe, fast am Gipfel des 7126 Meter hohen Himlung Himal.
In der Nacht hatten wir kaum geschlafen, uns im Zelt zu dritt aneinandergedrängt, bei 30 Grad unter null. In unseren Blutbahnen war der Sauerstoffgehalt auf Werte gesunken, die sonst Intensivpatienten aufweisen. Genau das hatten wir geplant.

Das medizinische Forschungsteam, mit dem der Fotograf Stefen Chow und ich am Himlung Himal unterwegs waren, wollte genauer herausfinden, was im menschlichen Körper passiert, wenn der Sauerstoff knapp wird: wie Zellmembranen, Gehirngewebe und Lungenflügel leiden. An solchen Effekten der Hypoxie leiden in Kliniken weltweit Abertausende von Patienten. Diese aber sind meist zu labil, um Versuchsreihen auszuhalten. Wie könnten Therapien hierzu verbessert und individuell angepasst werden?
Um dem nachzugehen, war das Ärzteteam aus der Schweiz, Deutschland und Nepal 2013 zu einem gewagten Experiment aufgebrochen: Es begleitete eine Gruppe gesunder Bergsteigerinnen und Bergsteiger und vermaß deren Lebensfunktionen während des Aufstiegs im Hochgebirge mit medizinischen Hightech-Geräten. Die Ergebnisse sollten später in den Klinikalltag übertragen werden. Bis in die "Todeszone" der Atmosphäre mussten wir dafür vordringen – in jene Höhen also, in denen der Körper sich nicht mehr vom Sauerstoffmangel erholen kann.
Die Probanden schaffen einen Weltrekord
Von den 39 Probanden, mit denen wir im Basislager gestartet waren, schafften es 15 tatsächlich bis in das höchste Laborcamp: ein Weltrekord. Mehr als 7000 Blutproben und noch mehr Ultraschallbilder trugen die Medizinerinnen und Mediziner im Lauf der gut vier Wochen am Berg zusammen, Hunderte Elektrokardiogramme, Belastungsprotokolle und Atemkraftwerte. Das Experiment war geglückt – wobei natürlich am wichtigsten war, dass alle Beteiligten überlebt hatten und sich innerhalb weniger Tage von den Erfrierungen, den Folgen der Höhenkrankheit und den Belastungen unserer Reise erholen konnten. Auch ich selbst spürte rund zwei Wochen nach unserer Rückkehr wieder meine Fingerkuppen.
Unsere Datenberge auszuwerten gleicht nun einer eigenen Expedition. Sie dauert noch an und bringt immer wieder bemerkenswerte Erkenntnisse mit sich. So belegen die Daten etwa, dass der menschliche Körper erstaunlich viele sensible Regelungskreise zugleich nutzt, um physiologisch auf Sauerstoffmangel zu reagieren: Er bildet mehr Kapillargefäße und verbessert damit den Blutkreislauf, er passt den Hormonhaushalt, das System zur Gewinnung von Energie und Gerinnungsfaktoren an. Eine gemäßigte Hypoxie scheint die Widerstandskräfte des Körpers dadurch sogar stärken zu können – was in der Krankenhausmedizin gezielt eingesetzt werden könnte.
Eine entscheidende Rolle in diesem Prozess der Sauerstoffregulierung, so weiß man inzwischen, spielt in den Zellen der Proteinkomplex Hypoxia Inducible Factor (HIF), für dessen Entdeckung 2019 sogar der Nobelpreis in Medizin verliehen wurde. Die molekularen Schaltkräfte von HIF sind so mächtig, dass sie nun auch bei der Behandlung von Blutarmut, Nierenversagen und in der Krebstherapie helfen sollen.

Die Atemnot an den Hängen des Himlung Himal hat damals viele aus unserem Expeditionsteam bis an die Grenze der Kräfte gebracht. Auch mich. Aus Hirnscans der Probanden ließ sich im Nachhinein ablesen: Die symptomatischen Vorboten einer lebensbedrohlichen Schädigung des Gehirns sind in so großen Höhen von außen oft nicht mal für Ärzte erkennbar. Man könnte jederzeit umkippen, selbst bei größter Vorsicht.
Ich selbst habe deshalb entschieden, in Zukunft nicht mehr auf Gipfel in so dünner Luft zu steigen. Und auch die Expeditionsleitung möchte angesichts der Gefahren keine vergleichbaren Reisen mit großen Probandengruppen mehr unternehmen.
Aber die neuen Erkenntnisse zu den Anpassungsgrenzen des Körpers und die bahnbrechenden Entwicklungen in der Hypoxieforschung, die sich seither ergeben haben, zeigen auch: Unser Experiment war nicht sinnlos. Es lohnt, für die Wissenschaft immer wieder auch ungewöhnliche Wege zu gehen – im Hochgebirge wie im Labor.