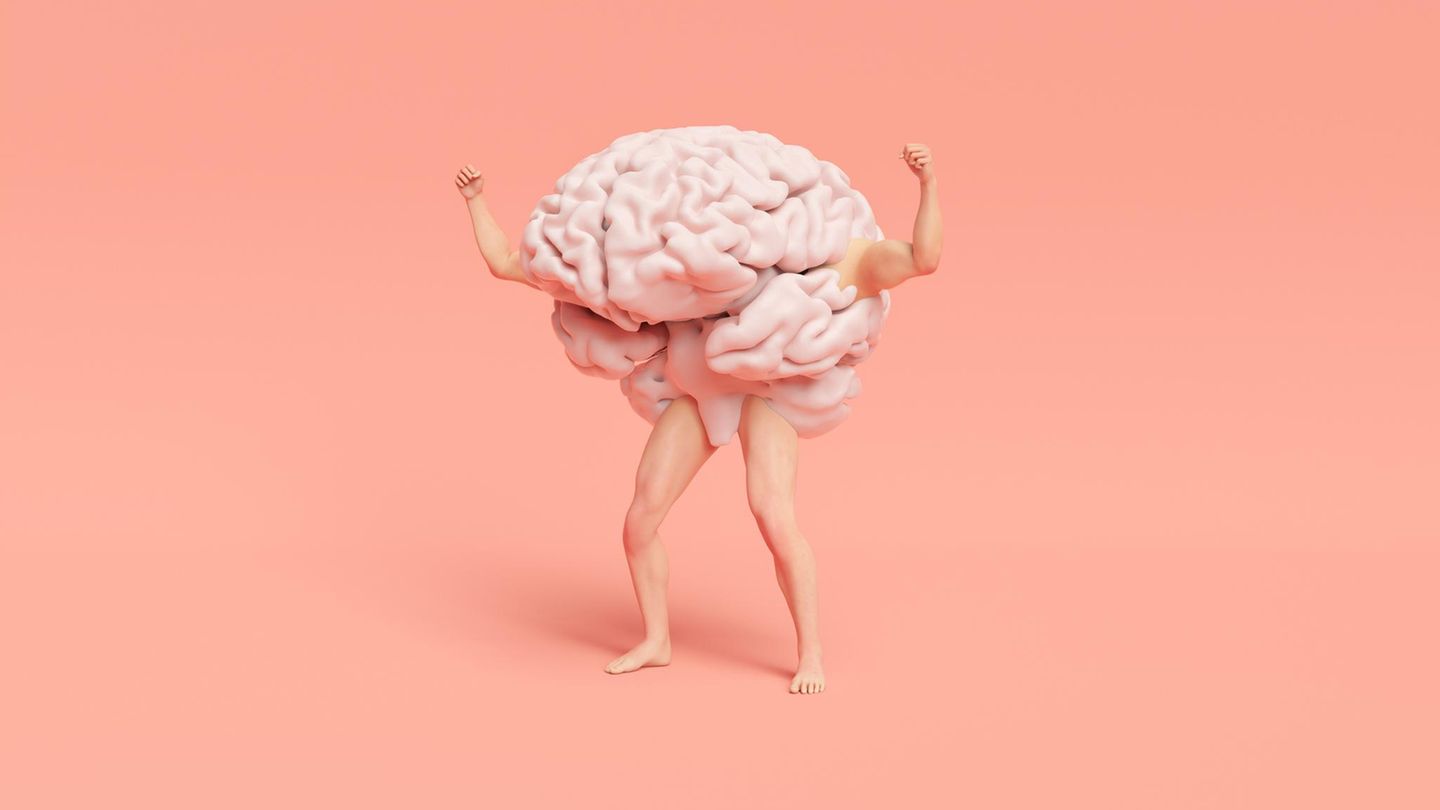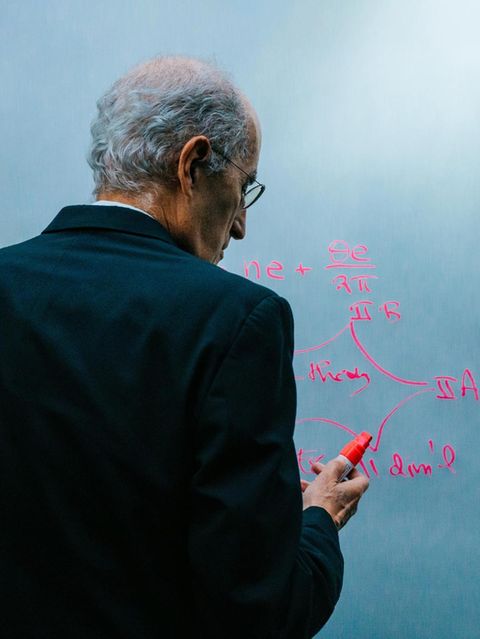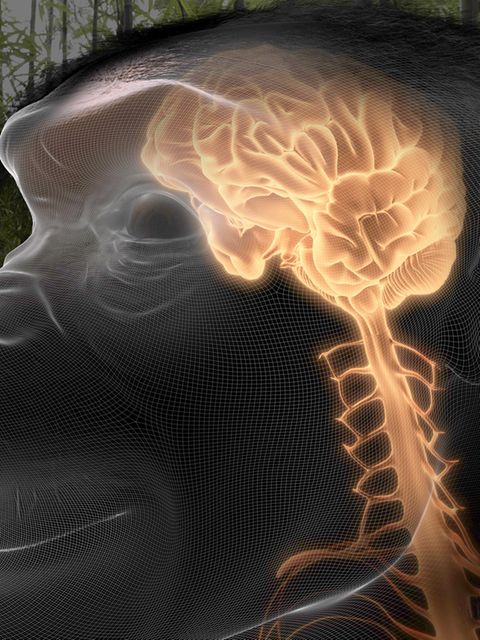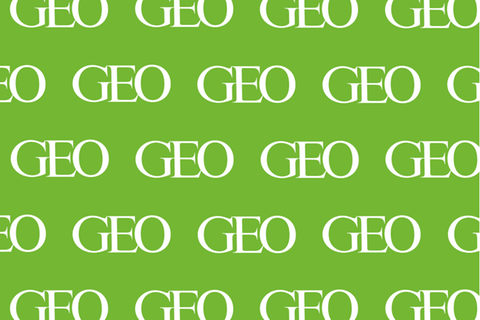Autismus scheint, ebenso wie Schizophrenie, nur beim Menschen aufzutreten. Bislang sind kaum Beobachtungen bekannt, in denen Verhaltensweisen von nicht-menschlichen Primaten mit der Autismus-Spektrum-Störung in Verbindung stehen. Ein Grund dafür ist simpel: Solche Verhaltensweisen beruhen in der Regel auf kognitiven Merkmalen wie Sprachproduktion und Sprachverständnis, die entweder einzigartig für den Menschen sind oder bei ihm viel ausgeprägter sind als bei anderen Lebewesen.
Zwei Biologen der Universität Stanford, Alexander L. Starr und Hunter B. Fraser, haben nun Hinweise gefunden, warum die Evolution diese Störung in Kauf nahm, ja sogar die menschliche Entwicklung in diese Richtung trieb. Ihre Ergebnisse erschienen in "Molecular Biology and Evolution", veröffentlicht von Oxford University Press.
Die Biologen untersuchten, wie sich die Neuronen im Gehirn änderten, als sich die Entwicklung des Menschen von der anderer Primaten immer weiter trennte. Sie entdeckten, dass sich ausgerechnet der häufigste Neuronentyp in der Großhirnrinde, die L2/3-IT-Neuronen, evolutionär außergewöhnlich schnell veränderten. Das ist überraschend, denn nach einer Faustregel entwickelt sich in der Evolution das, was besonders häufig ist, evolutionär eher langsam. Vereinfacht lässt sich das so erklären, dass Änderungen an einem häufig verwendeten Bauteil in einem System größere Probleme verursachen als Änderungen an einem selten verwendeten Bauteil. Daher werden Änderungen an häufigen Zelltypen durch die natürliche Auslese stärker "gebremst".
Die Änderungen an den L2/3-IT-Neuronen müssen also enorme Vorteile gebracht haben, weshalb sie durch die natürliche Selektion ausnahmsweise bevorzugt wurden. Es liegt nahe, dass diese Neuronen, die entscheidend für die Integration von Signalen über kortikale Bereiche hinweg sind, damals die menschliche Fähigkeit verbesserten, komplex zu denken und Sprache zu nutzen.
Die Biologen fragten sich, welche Änderungen im Genom diese Veränderung der Neuronen ausgelöst haben könnten. Sie entdeckten, dass sich die Veränderungen auf bestimmte Gene zurückführen lassen könnten, die weniger aktiviert ("exprimiert") wurden. Beispielsweise tritt das Gen DLG4 beim Menschen 2,5-mal weniger in Erscheinung als beim Schimpansen.
Bei den betreffenden Genen handelt es sich just um jene, die bei Menschen mit Autismus besonders wenig aktiv sind. Während ein bisschen weniger Aktivität also einen Vorteil liefert, scheint zu wenig Aktivität Autismus zu befördern. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass einige der gleichen genetischen Veränderungen, die das menschliche Gehirn einzigartig machen, auch zu einer größeren Neurodiversität beim Menschen geführt haben", sagt Alexander L. Starr.
Die zwei Biologen spekulieren über eine hypothetische Expressionsschwelle für Autismus: Liegt die Aktivität der Gene darunter, ist die Wahrscheinlichkeit für Autismus stark erhöht. Dass die Evolution die Entwicklung des Menschen in Richtung dieser Schwelle trieb, brachte offenbar einen enormen Vorteil, der die Nachteile aufwog. Doch welcher könnte das sein?
Die Biologen haben dazu zwei Vermutungen. Entweder hat die geringere Aktivität des Gens zu einer besseren Sprachproduktion und einem besserem Sprachverständnis geführt. Oder, besonders spannend, sie hat die Entwicklung des Gehirns nach der Geburt verlangsamt. Was zunächst unvorteilhaft klingt, könnte ein entscheidender Grund sein, warum Menschen komplexer denken können. Denn indem sich das Gehirn des menschlichen Säuglings langsamer entwickelt als beispielsweise das eines neugeborenen Affen, hat es mehr Zeit, komplexere Strukturen und Funktionen zu entwickeln.
Es bleiben also noch Fragen offen, wie auch Alexander L. Starr betont, etwa zu den evolutionären Zusammenhängen zwischen Kognition und Autismus. Einerseits lassen sich die Beobachtungen so deuten, dass der Mensch anfälliger für äußere Störungen wurde – die Folge ist Autismus. Andererseits könnte die evolutionäre Veränderung den Menschen in Richtung eines Autismus-ähnlichen Phänotyps gedrängt haben. Dann wäre Autismus weniger als Abweichung zu verstehen: Durch die Entwicklung Richtung Autismus wären wir erst zu den Menschen geworden, die die Welt erobern konnten. Neurodiversität wäre somit ein integraler Bestandteil der Evolution unseres menschlichen Gehirns.