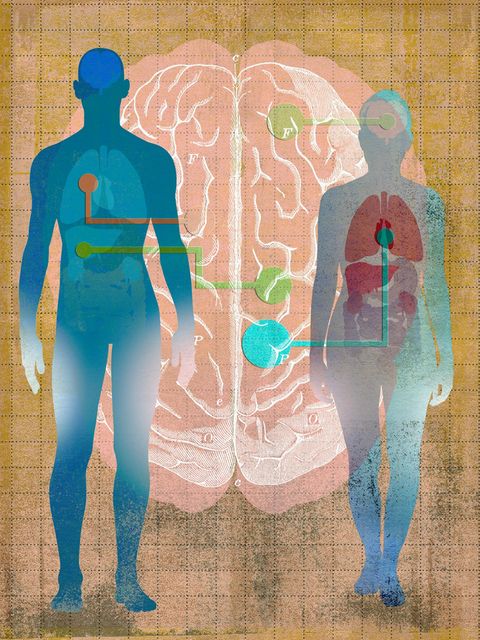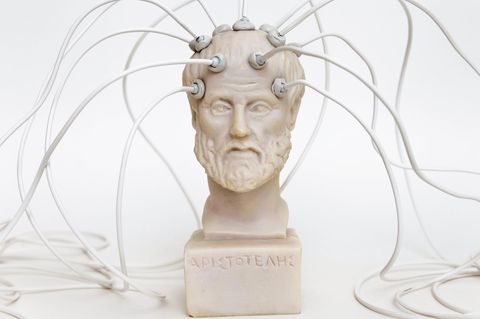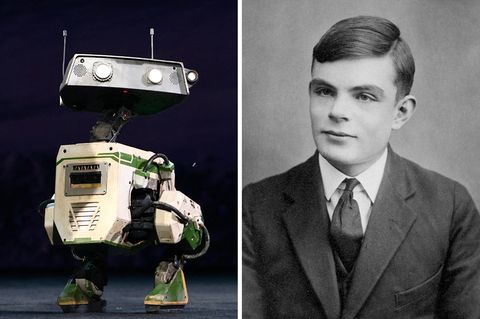Die Aufgabe ist simpel: Ein großes "T" soll von einer Ecke des Raums in die andere getragen werden. In der Mitte versperren zwei Wände den Weg, lassen nur einen schmalen Spalt frei. Das T muss auf eine sehr spezifische Weise hindurchrangiert werden. Grips ist gefragt.
Es tritt an: Homo sapiens. Biblischer Herrscher über Pflanzen und Tiere, die selbsternannte Krone der Schöpfung, das klügste aller Wesen.
Sein Kontrahent: Paratrechina longicornis. Drei Millimeter groß, pechschwarz und eine Ameise.
Zunächst wetteifern die Arten im Einzel gegeneinander. Die Unparteiischen, ein Forschungsteam des Weizmann Institute of Science in Israel sorgt dabei für Chancengleichheit: Jeder trägt ein T, das seiner Kraft und Körpergröße entspricht. Noch ist der Mensch der klare Sieger. Die Probanden tasten sich vorsichtig in den Engpass der zwei Trennwände, lösen das geometrische Problem in Windeseile. Die vereinzelten Ameisen hingegen – aus Motivationsgründen wird ihnen vorgegaukelt, sie trügen Futter nach Hause – schaffen es selten, auf Anhieb die richtige Lösung zu finden.
Als Individuum gewinnt der Mensch das Duell. In der Gruppe die Ameise
Auch in der Gruppe stellt sich Homo sapiens geschickt an. Bis zu 26 Menschen diskutieren nun, wie sie das T am sinnvollsten in die Öffnungen schieben, um nicht stecken zu bleiben, tauschen Argumente aus, finden einen Konsens. Die Ameisen, bis zu 80 von ihnen kooperieren nun, sind deutlich wortkarger, finden aber beinahe ebenso effiziente Lösungen. Das Gruppenduell endet unentschieden.
Endgültig wendet sich jedoch das Blatt, sobald Homo sapiens seiner Kommunikationsmittel beraubt wird. Stumm sollen die Probanden nun allein anhand der physischen Kraft, die sie auf das Objekt ausüben, eine kollektive Lösung für das Rangierproblem finden. Und scheitern kläglich. Immer wieder schieben sie das T in eine Sackgasse, oftmals sogar in dieselbe. Ohne Sprache ist der Mensch zum Ausprobieren verdammt: Informationen fließen nicht mehr effizient genug durch die Gruppe, Lösungen für komplexe Probleme findet sie erst nach einigen Fehlschlägen.
Sind wir also, zumindest in Gruppen, dümmer als Ameisen? Oder, wie andernorts über die jüngst im Fachmagazin "PNAS" erschienene Studie berichtet wurde: Kooperieren Ameisen besser als Menschen?
Nein. Würde man Ameisen ihrer natürlichen Kommunikationsmittel berauben, sie etwa in hermetisch abgeriegelte Boxen sperren und sie per Telefonkonferenz komplexe Probleme lösen lassen, hörte man: Stille. Die gesamte Physiognomie und Kognition von Paratrechina longicornis ist auf ein Leben als Ameise ausgerichtet. Darauf, in Gruppen, große Gegenstände zu transportieren und Erkenntnisse, etwa über anstehende Hindernisse, stumm zu vermitteln. Je nach Situation, in der sie sich befinden, bilden Ameisengruppen eine flüchtige Art kollektiver Intelligenz. Mit menschlichen Formen solch "emergenter Intelligenz" ist die Klugheit der Ameisen nicht vergleichbar. Beide sind kaum in Relation zu setzen, hat die Evolution sie doch exakt für jene Nischen geschaffen, die die jeweilige Art besetzt. Müsste er ein Leben als Ameise führen, wäre auch der klügste Mensch aufgeschmissen. Das gilt andersherum genauso.
Der Mensch beginnt gerade erst, andere Intelligenzen zu verstehen
Die Erkenntnis der PNAS-Studie liegt woanders. Sie bestätigen ein neues, revolutionäres Bild vieler Tiere, das die Verhaltensforschung seit geraumer Zeit zeichnet. Die menschliche Form der Intelligenz, das zeigen etliche Studien, ist weder die einzig mögliche noch die in allen Situationen überlegene. Hummeln benutzen Werkzeuge. Ratten empfinden Mitleid mit Artgenossen. Vögel können sich in andere hineinversetzen. Jede dieser Fähigkeiten ist nützlich in der Lebenswelt der jeweiligen Art. Das gilt auch für die kollektive Intelligenz der Paratrechina longicornis: Dass sich ihre kognitive Leistungsfähigkeit stark erhöht, sobald die Tiere kooperieren, ist aus evolutionärer Sicht nur konsequent.
Der Mensch beginnt gerade erst, solche, ihm weitestgehend fremde Formen der Intelligenz zu verstehen. Je besser dies gelingt, desto mehr bröckelt die künstlich errichtet Barriere zwischen dem vermeintlich einzig vernunftbegabten Wesen Homo sapiens und dem instinktgetriebenen Rest der Tierwelt.
80 winzige Ameisen, die ein T durch ein Labyrinth bugsieren, sind ein kleines Puzzlestück in diesem Wandel. Nicht weniger. Aber auch nicht mehr.