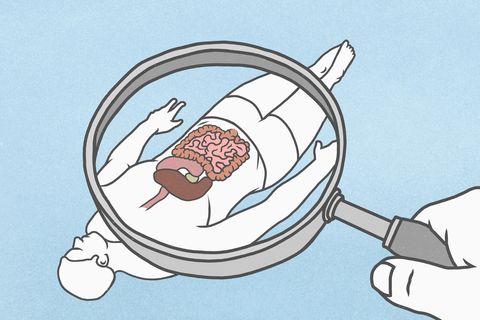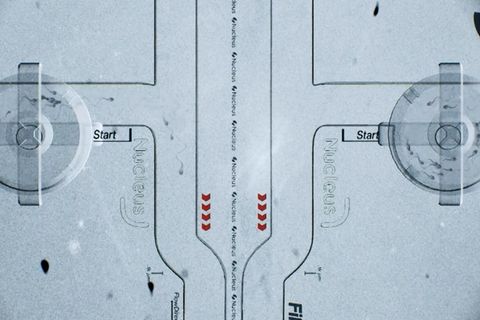Testosteron ist berühmt als Hormon, das aus Jungen Männer macht. Es stößt bereits im Mutterleib die Entwicklung der Geschlechtsorgane an. In der Pubertät lässt es Muskeln und Haare sprießen, erhöht die Ausdauer und regt das Wachstum des Kehlkopfs an. Es wirkt sich auch auf die Gehirnentwicklung aus. Im Volksmund steht es deshalb häufig synonym für Machismo und Platzhirschgehabe.
Doch Testosteron ist mehr als ein chemisches Destillat der Männlichkeit. Es steuert und beeinflusst eine Vielzahl wichtiger Prozesse im Körper – übrigens auch bei Frauen. Die durchschnittlichen Blutwerte gesunder Männer liegen nach der Pubertät zwischen zwölf und 30 Nanomol Testosteron pro Liter. Mangelt es ihnen an dem Geschlechtshormon, bekommen sie das empfindlich zu spüren. Sie fühlen sich schlapp und antriebslos, sind niedergeschlagen, leiden womöglich sogar unter Blutarmut. Die Muskelmasse schwindet, die Haare wachsen langsamer. Knochendichte und Libido sinken. Auch die Fruchtbarkeit nimmt ab, weil weniger Spermien in den Hoden heranreifen. Oft sinkt der Pegel mit dem Alter und den damit einhergehenden Gebrechen.
Im Internet kursieren verschiedenste Empfehlungen dazu, wie sich der Testosteronspiegel mithilfe von Lebensmitteln steigern lässt. Zwiebeln und Knoblauch werden angepriesen, Austern als Aphrodisiakum verkauft. Eine fettreiche Ernährung gilt mal als empfehlenswert, mal als abträglich. Ein deutscher Urologe warnt eindringlich vor Zucker als "Testosteronkiller Nummer eins"; ein US-amerikanischer Urologe beschwichtigt: Einfache Kohlenhydrate seien in Maßen kein Problem. Ein genauer Blick auf die Hormonforschung hilft, solche Empfehlungen und Widersprüche besser einzuordnen.
Fest steht: Wer unter einem diagnostizierten Testosteronmangel leidet, für den empfiehlt sich in vielen Fällen eine Therapie mit Ersatzpräparaten. Sie geben dem Körper, was ihm fehlt, sei es vorübergehend oder dauerhaft. Eine Ernährungsumstellung kann dabei unterstützen, den Hormonspiegel langfristig auf ein gesundes Niveau zu heben und dort zu halten.