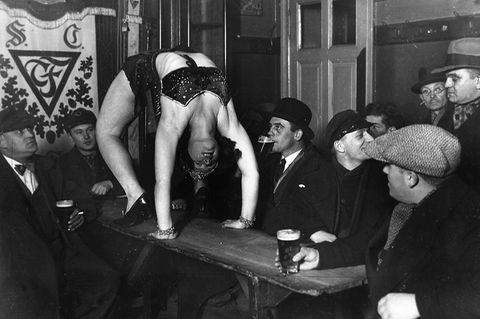Es ist ein langer Trauerzug, der sich am 16. November 1831 durch die Berliner Friedrichstraße bewegt. Hinter einem vierspännigen Wagen mit der Leiche Georg Wilhelm Friedrich Hegels gehen Hunderte von Studenten. In den Händen tragen sie mit Trauerflor umwickelte Fackeln. Als sie den schneebedeckten Dorotheenstädtischen Friedhof vor dem Oranienburger Tor erreichen, stimmen sie einen Choral an.
In der Aula der Universität hat der Rektor zuvor das Wirken des Philosophen gewürdigt: Wer wie Hegel "einen neuen Bau des Wissens gegründet hat auf dem unwandelbaren Fels des Geistes, der hat sich eine Unsterblichkeit errungen".
Berlin trauert: um Preußens König der Gedanken.
Dessen Weg zum Ruhm beginnt 1801 an der Universität Jena. Dort blüht in der Nachfolge Immanuel Kants, häufig aber auch in Opposition zum Denken des Königsbergers, die Philosophie des deutschen Idealismus - jener Geistesrichtung, die bestrebt ist, die Grundlagen absoluter Erkenntnis und damit das Absolute selbst offen zu legen. Und dort beginnt der 31-jährige Hegel, als Privatdozent seine eigene Lehre zu entwickeln.
Hegel versteht Philosophie nicht, wie noch Kant, als reine Kritik des menschlichen Erkenntnisvermögens, sondern als logische Wissenschaft, welche die gesamte Geschichte des Denkens reflektieren muss. Mit der Schrift "Phänomenologie des Geistes" schafft er 1807 die Grundlagen seines umfassenden philosophischen Systems, das die Wirklichkeit begreifbar, das Absolute erkennbar machen soll.
Alles Reale, so Hegel, sei vom "Weltgeist" durchdrungen und auf diesen zurückzuführen.
Der Philosoph bezieht Natur, Religion, Kunst und Geschichte in sein System mit ein, dessen universaler Anspruch die Zeitgenossen beeindruckt und sein Ansehen als Gelehrter wachsen lässt. 1816 wird er Professor in Heidelberg. Doch schon ein Jahr später will Berlin ihn haben - das neue Zentrum der Wissenschaft. Dabei ist die im ehemaligen Prinzenpalais Unter den Linden beheimatete Universität der Stadt erst acht Jahre alt.
Wilhelm von Humboldt, der spätere große Bildungsreformer, hat als höchster preußischer Beamter für das Bildungswesen ab 1809 die Neugründung entscheidend geprägt. Er wünscht sich eine Hochschule neuen Typs.
Die preußische Lehranstalt gründet auf den Humboldtschen Bildungsidealen: Wissenschaft ist nie abgeschlossen, sondern ein fortwährendes Suchen; Forschung und Lehre gehören eng zusammen; die Studenten der Fakultäten Philosophie, Theologie, Medizin und Jura sollen sich umfassend humanistisch bilden.
Ihre inneren Angelegenheiten regelt die Universität selbst, der preußische Staat finanziert sie und ernennt die Professoren. 1817 entsteht ein Kultusministerium. Und dessen Leiter Karl Freiherr vom Stein zum Altenstein setzt alles daran, Gelehrte mit prestigeträchtigen Namen nach Berlin zu holen. Männer wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Der neue Professor tritt sein Amt am 22. Oktober 1818 an. Schon lange hat ihn der preußische Staat angezogen - nun lobt er ihn gleich in seiner ersten Rede: Mit allen Kräften habe die Regierung das Land nach der Niederlage gegen Frankreich wieder aufgebaut.
Preußen habe sich durch sein geistiges Übergewicht "an Macht und Selbstständigkeit solchen Staaten gleichgestellt, welche ihm an äußeren Mitteln überlegen gewesen wären".
Der Staat ist für Hegel die "Verwirklichung der Freiheit"
Fünf Nachmittage pro Woche steht der Philosoph am Katheder; bleich im Gesicht und wenig redegewandt. "Fast bei jedem Ausdruck krächzte er, räusperte sich, hustete, verbesserte sich ständig", berichtet ein Student. Aber Hegels Gedanken ergreifen die Hörer, zumal er seine Vorträge mit sarkastischen Bemerkungen würzt. Zunehmend mehr Studenten hören seine Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte und zur Geschichte der Philosophie, zu Logik oder Metaphysik.
Ende 1820 veröffentlicht er ein Buch, das seine Beziehung zu Preußen weiter vertieft. In den "Grundlinien der Philosophie des Rechts" feiert Hegel den Staat als höchste Form des menschlichen Zusammenlebens: Dessen Institutionen ließen die Interessen des Einzelnen in dem höheren Zweck der Allgemeinheit aufgehen. Der Staat ist für Hegel die "Verwirklichung der Freiheit". Und diese Freiheit, meint der Philosoph, werde am besten durch die konstitutionelle Monarchie gesichert.
Auch wenn er es in den "Grundlinien" nie direkt sagt - Hegels ganze Bewunderung gilt dem preußischen Staat. Vielen Vertretern der Macht gefällt das. Manche Liberale erfüllen die Ausführungen jedoch mit Wut. Denn mittlerweile zeigt der Staat an den Universitäten seine reaktionäre Seite.
Nach dem Wiener Kongress von 1814/15 haben sich patriotisch gesinnte Studenten in Burschenschaften zusammengetan, um für einen freiheitlichen Nationalstaat zu kämpfen - eine revolutionäre Bedrohung in den Augen vieler Fürsten des Deutschen Bundes.
Schüler Hegels werden verhaftet
Seit der Ermordung des konservativen Dichters August von Kotzebue durch einen Burschenschafter im März 1819 gehen die Herrscher hart gegen die liberalen "Demagogen" vor: Die Burschenschaften werden verboten und scharfe Zensurbestimmungen erlassen. Über jede Universität wacht nun ein Regierungskommissar.
In Preußen schlägt der Staat besonders hart zu. Verdächtige Studenten kommen ins Gefängnis, allzu freiheitlich denkende Professoren müssen die Universitäten verlassen. Auch Schüler Hegels werden verhaftet. Dies alles, zürnen manche Liberale, rechtfertige der Professor.
Heißt es doch schon im Vorwort seiner Schrift: "Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig." Ist Hegel also ein Handlanger der Unterdrücker? Die Kritiker übersehen, dass es dem Denker stets um das Preußen der Reformzeit geht.
Den Ruf des "preußischen Staatsphilosophen" wird Hegel jedoch nicht wieder los. Zugleich aber gerät auch er mit den konservativen Kreisen aneinander: Mehrmals wird ihm unterstellt, seine Religionsphilosophie sei atheistisch. In einem Staat, in dem Thron und Altar eng miteinander verbunden sind, kann so ein Verdacht gefährlich werden.
Doch Hegel hat einen einflussreichen Fürsprecher: den Kultusminister Altenstein. Der setzt alles daran, seine Kulturpolitik gegen die konservative Hofpartei zu verteidigen. Er weist nicht nur Klagen gegen Hegel zurück, sondern verschafft ihm Reisezuschüsse und einen Nebenposten bei der staatlichen Schulaufsicht.
Zunehmend zieht der Kopf der deutschen Philosophie nun auch die Berliner Gesellschaft in seinen Bann. Ein Student bemerkt: "Ob irgendein genialer Gedanke in den Wissenschaften in die gelehrte Welt einschlug oder das Fräulein Sonntag im Konzert sang, in allen Fällen fragte Berlin: Was denkt Hegel darüber?" Wenn der Meister liest, drängen sich im Hörsaal die Menschen, darunter Offiziere und Geheimräte.
Der Philosoph prägt das preußische Geistesleben
Keiner prägt das preußische Geistesleben in diesen Jahren so stark wie Hegel mit seiner optimistischen Mischung aus Staatsverehrung und Freiheitsliebe. Auch dank ihm gilt Preußen vielen im Ausland als Wissensmacht. 1829 wählen ihn die Kollegen für ein Jahr zum Rektor der Universität. Diese hat nun mehr als 2000 Studenten. Weitere Lehranstalten werden nach dem Humboldtschen Modell reformiert oder neu gegründet.
Am 14. November 1831 verliert die Berliner Hochschule ihre Symbolfigur. Georg Wilhelm Friedrich Hegel stirbt nach kurzer Krankheit im Alter von 61 Jahren - die Ärzte diagnostizieren Cholera. 41 Semester hat er gelehrt und fast 90 Vorlesungen gehalten. Fortan lebt sein Denken im "Hegelianismus" seiner Anhänger fort. "Sein Name wird somit", sagt einer von ihnen an Hegels offenem Grab, "den anderen gefeierten Namen, welche Preußen berühmt machten, hinzugefügt."