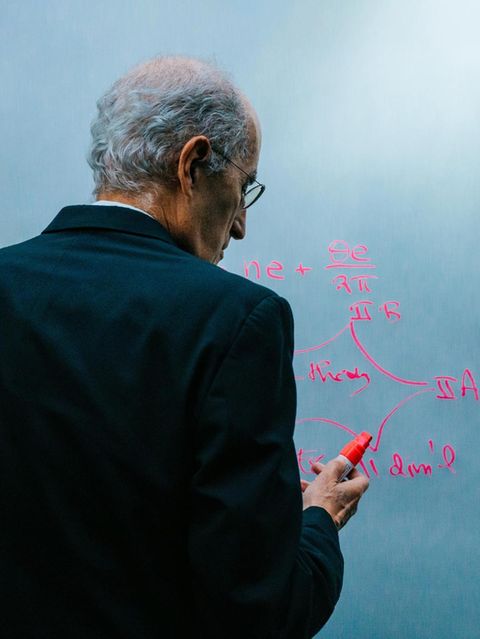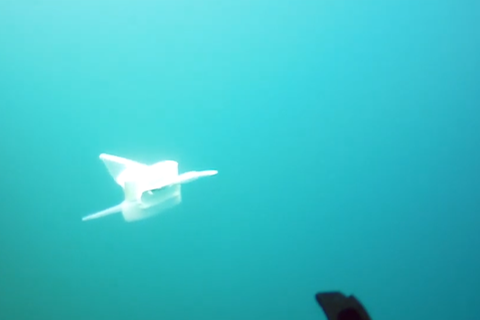Ob kühles Bier oder knackiges Gemüse, würziger Käse oder süße Desserts – all das finden wir Tag für Tag (und manchmal nachts) im Kühlschrank. In 99 Prozent der deutschen Haushalte verrichten die Geräte leise surrend ihren Dienst. In ihrem Inneren produzieren sie, so scheint es, Kälte.
Was genau ist eigentlich Kälte?
Die Antwort der Thermodynamik – jenem Teilgebiet der Physik, mit dem Forscher Temperaturphänomene zu erklären versuchen– ist zunächst ernüchternd: Eine physikalische Größe "Kälte" gibt es überhaupt nicht. Was hingegen Wärme ist, davon haben Physiker eine sehr genaue Vorstellung: Wärme ist Energie. Denn je heißer ein Objekt ist, desto heftiger bewegen sich die Atome und Moleküle, aus denen es besteht.
Physikalisch gesehen, erzeugt ein Kühlschrank also keine Kälte, sondern entzieht seinem Innenraum und den darin gelagerten Lebensmitteln Wärme, transportiert sie nach außen und gibt sie an die Umgebung ab.
Doch dem Transport von Wärme hat die Natur Grenzen gesetzt, denn ein weiteres fundamentales Prinzip der Physik lautet: Wärme fließt von selbst immer nur vom wärmeren zum kälteren Körper – so lange, bis beide die gleiche Temperatur haben. Ein Kühlschrank muss also beständig gegen das Streben nach Ausgleich arbeiten und die Wärme gegen ihre natürliche Flussrichtung pumpen.
Kühlschrank hat unsere Lebenserwartung erhöht
Um das zu erreichen, zirkuliert ein Kühlmittel durch Rohrleitungen auf Innen- und Außenseite des Eisschranks. Damit es die Wärme des Innenraums aufnehmen kann, muss es kälter sein als der Innenraum. Das wird durch einen Trick erreicht: An der Außenseite des Eisschranks ist das Kühlmittel flüssig und steht unter hohem Druck.
Von dort strömt es durch eine sehr kleine Öffnung in die Rohrleitungen im Inneren, wo der Druck durch stetiges Absaugen des Kühlmittels weitaus geringer wird. Dadurch dehnt es sich in den Leitungen aus, verdampft und kühlt dabei stark ab (aus dem gleichen Grund fühlt sich Deo kalt an, das aus der Spraydose strömt).
Auf dem Weg durch das Leitungslabyrinth innerhalb des Kühlschranks kann das Mittel nun Wärme aufnehmen – es ist ja kälter als der Innenraum. Erreicht es die Leitungen an der Rückseite des Geräts, ist es allerdings immer noch kälter als die Umgebung. Es mag paradox klingen, doch damit das Mittel die innen aufgenommene Wärme an der Außenseite wieder abgeben kann, muss ihm noch weitere Wärme zugeführt werden.
Denn schließlich "fließt" die Wärme ja stets vom wärmeren zum kälteren Ort, an der Rückseite des Eisschranks muss die Temperatur des Kühlmittels also höher sein als die im Raum.
Um dies zu erreichen, wird das Mittel durch einen Kompressor zusammengedrückt, dabei wird es erneut zur Flüssigkeit und erwärmt sich ganz automatisch. Mithin wandelt der Kompressor – indem er das Kühlmittel verdichtet – elektrische Energie in Wärme um und überträgt diese an das Mittel.
Der Kühlschrank transportiert also nicht nur Wärme nach außen, sondern muss an der Außenseite gewissermaßen für zusätzliche Hitze sorgen, damit die Wärmeabgabe funktioniert – und damit der Kreislauf des Kühlens. Das ist der Grund, warum ein Eisschrank nach außen mehr Wärme abgibt, als er dem Innenraum entzieht.
Doch der Energieaufwand lohnt sich: Dass unsere Lebenserwartung heute höher ist denn je, haben wir auch der Kühltechnik zu verdanken. Sie ersetzte in den letzten 50 Jahren in Privathaushalten zunehmend andere Konservierungsmethoden wie Einsalzen und Pökeln, bei denen unter anderem Nitrat und Nitrit verwendet wurden – Ausgangssubstanzen für gefährliche krebserregende Verbindungen.
So bewahren Kühlschränke nicht nur die Frische und den Vitamingehalt von Lebensmitteln, sondern haben auch dazu beigetragen, dass Magenkrebs in Ländern wie Deutschland immer seltener auftritt.