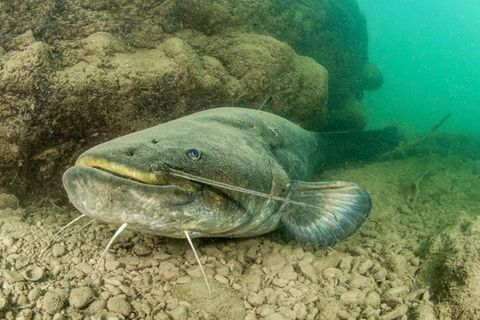Schnee und Eis, das ist nichts für Schmetterlinge. Deshalb sind winters auch keine Falter zu sehen – außer man hat sehr viel Glück. Nur die wenigsten überstehen die Kälte unbeschadet. Darunter der Zitronenfalter. Wenn erster Raureif die Felder bedeckt, versteckt er sich im Unterholz oder in einer Baumspalte. Dort steht er selbst frostigste Nächte durch. Bis minus zwanzig Grad erträgt er.

Der Trick: Seine Körperflüssigkeit enthält Zuckerstoffe (Glyzerin), die verhindern, dass sie gefriert. Außerdem scheidet der Zitronenfalter zu Beginn der kalten Tage einen Teil seiner Leibessäfte aus. Er lässt praktisch alles Wasser ab, das er nicht braucht.
Kopfunter in Winterstarre
Und erwärmt die Wintersonne zwischendurch einmal die Luft, wagt er sich hinaus, um durch die Schneelandschaft zu flattern. Vollends aktiv werden Zitronenfalter aber meist im März. Damit zählen sie zu den ersten Boten des Frühlings. Falls sie noch keinen Nektar finden oder die Temperaturen so früh im Jahr noch einmal unter Null sacken sollten, lassen sie sich einfach erneut kopfunter in Winterstarre fallen. Das körpereigene Frostschutzmittel bewahrt sie ja vor Unheil.
Mit steigenden Celsiusgraden locken schließlich nicht nur Löwenzahn, Weidenkätzchen und Co: Bis in die erste Maihälfte finden sich Paare. Dann patroullieren die leuchtend gelben Männchen an Waldrändern und -wegen, wirbeln in wilder Jagd den weißlich-grün gefärbten Weibchen hinterher. Lässt sich die Angeflatterte auf den Boden nieder, kommt es zum Sex, der bis zu drei Stunden dauern kann.
Nach der Fortplanzung fliegen beide noch einige Wochen, bis sie sterben. Da manche bereits im Juni des Vorjahres geschlüpft sind, erreichen Zitronenfalter eine Lebensspanne von nicht selten elf bis zwölf Monaten. Damit sind sie die am längsten lebenden Tagfalter Deutschlands.