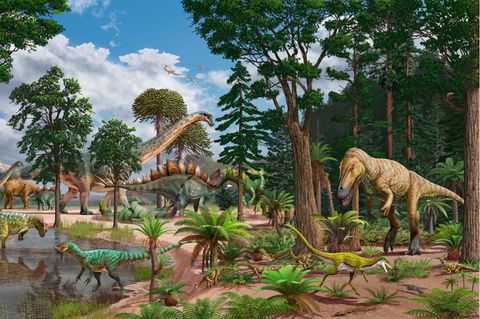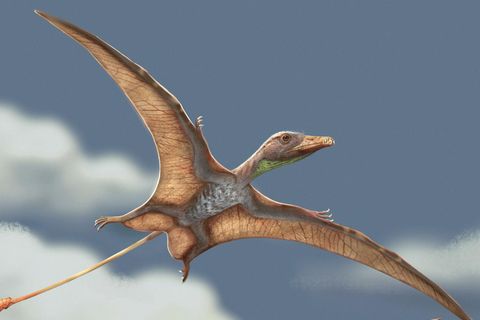Krokodile sind raffinierte Jäger. Regungslos lauern sie unter der Wasseroberfläche, nur ihre aufmerksamen Augen ragen aus dem Wasser und verraten ihre Anwesenheit. Nähert sich ahnungslose Beute, schießen die Räuber blitzschnell in die Luft und packen ihr Opfer mit ihren kräftigen Kiefern und spitzen Zähnen. Nicht so aber ein Urzeitkrokodil, das vor 55 Millionen Jahren das heutige Australien besiedelte – lange Zeit, bevor die modernen Salz- und Süßwasserkrokodile dort vor etwa 3,8 Millionen Jahren aufkreuzten. Das Krokodil aus der ausgestorbenen Gruppe der Mekosuchinae lebte überwiegend an Land und fühlte sich besonders im Wald wohl. Dort kletterte es auf Bäume, wartete geduldig darauf, dass sich am Boden Beute näherte – und stürzte sich dann aus dem Hinterhalt auf diese.
"Es ist eine bizarre Vorstellung", sagt Michael Archer von der University of New South Wales, der die Entdeckung gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam im "Journal of Vertebrate Paleontology" veröffentlicht hat. "Aber einige von ihnen waren offenbar zumindest teilweise semi-arboreale 'Drop Crocs'. Sie jagten möglicherweise wie Leoparden: Sie sprangen von Bäumen auf jede ahnungslose Beute, die ihnen als Abendessen gefiel", sagt Archer in einer Mitteilung der Universität.
Vermuten lassen das Funde in der Nähe der Stadt Murgon im Südosten von Queensland. Dort, in einer unscheinbaren Lehmgrube im Hinterhof eines Viehzüchters, öffnet sich ein Fenster in die Vergangenheit. Die Fossilien, die Forschende hier seit Jahrzehnten ausgraben, verraten, wie das Leben vor vielen Millionen Jahren aussah, als der australische Kontinent noch mit der Antarktis und Südamerika verbunden und die Gegend von einem sumpfigen Wald bedeckt war.
Die dort nun entdeckten Schalen von Krokodileiern sind die ältesten, die je in Australien gefunden wurden. Die Forschenden untersuchten sie unter optischen und elektronischen Mikroskopen und stellten dabei Erstaunliches fest: Die Mikrostruktur und chemische Zusammensetzung der Schalen zeigen, dass die Überreste der Gelege ausgetrocknet sind, nachdem die Jungen geschlüpft waren. Die Schlussfolgerung: Die Krokodile müssen in einem Ökosystem gelebt haben, das zumindest zeitweise trockenfiel. Vermutlich legten sie ihre Eier am Rande des Murgon Lake ab, der damals von einem dichten Wald umgeben war. In ihm lebten damals auch die ersten Singvögel der Welt, Australiens erste Frösche und Schlangen und zahlreiche kleine Säugetiere.
Anpassung an einen sich verändernden Lebensraum
Dort passten sich die Krokodile offenbar an die sich verändernden Lebensbedingungen an. Denn zur Zeit der Mekosuchine-Krokodile breiteten sich Trockengebiete aus – und in den schrumpfenden Gewässern mussten sie mit anderen räuberischen Neuankömmlingen um eine schwindende Zahl von Beutetieren konkurrieren. Die Jagd im Wald könnte deshalb eine gewinnbringende alternative Jagdstrategie gewesen sein. Bekannte Fossilien von 25 Millionen Jahre alten Urzeitkrokodilen hatten dieses Verhalten bereits vermuten lassen. Die 55 Millionen Jahren alten Eierschalen stützen diese These nun.
Dank der Schalen könne man nicht nur die seltsame Anatomie der Urkrokodile untersuchen, sondern auch ihre Fortpflanzung und Anpassung an veränderte Umweltbedingungen, sagt der Hauptautor der Studie, Xavier Panadès i Blas von Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont in Barcelona. Eierschalen seien in der Wirbeltierpaläontologie bislang eine zu wenig genutzte Ressource. "Sie bewahren mikrostrukturelle und geochemische Signale, die uns nicht nur Aufschluss darüber geben, welche Tierarten sie gelegt haben, sondern auch, wo sie nisteten und wie sie sich fortpflanzten", sagt Panadès i Blas. "Unsere Studie zeigt, wie aussagekräftig diese Fragmente sein können. Eierschalen sollten ein routinemäßiger, standardmäßiger Bestandteil der paläontologischen Forschung sein – und neben Knochen und Zähnen gesammelt, kuratiert und analysiert werden."