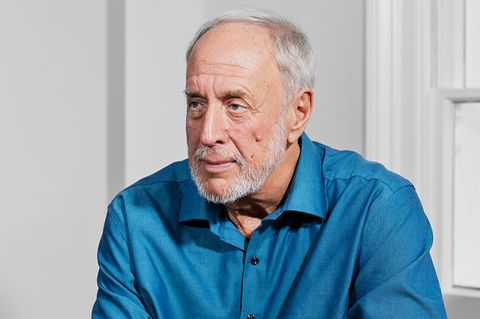Das neue Gentechnikgesetz
Seit 1990 gibt es in Deutschland ein Gentechnikgesetz, das den Umgang mit Gentechnik regelt. Doch das muss, um mit der gentechnischen Forschung Schritt zu halten, immer wieder angepasst werden. Die jüngste Gesetzesänderung wurde Ende Januar im Bundestag beschlossen. Unter anderem soll die neue Kennzeichnung "Ohne Gentechnik" die Orientierung für den Verbraucher vereinfachen. Was wird sich durch das neue Gentechnikgesetz ändern? In welchen Produkten muss der Verbraucher mit Gentechnik rechnen? Ist es überhaupt noch möglich, sich gentechnikfrei zu ernähren?
Seit im Jahre 1996 in den USA die ersten gentechnisch veränderten (gv-)Pflanzen angebaut wurden, ist die Anbaufläche weltweit auf 102 Millionen Hektar angewachsen. Zum Vergleich: Deutschland ist 35,7 Millionen Hektar groß. Die wirtschaftlich bedeutsamsten gv-Pflanzen sind Baumwolle, Soja, Mais und Raps. Heute liegt beispielsweise der Anteil des gv-Soja an der Weltproduktion bereits bei etwa 60 Prozent.
Um die Verbraucher darüber zu informieren, inwiefern sie mit gentechnisch veränderten Produkten in Berührung kommen, gelten schon seit 2004 neue Vorschriften zur Kennzeichnung von gv-Produkten: Demnach sind Lebensmittel, Zutaten und Zusatzstoffe dann zu kennzeichnen, wenn es sich dabei um gentechnisch veränderte Organismen (GVOs) handelt, oder die Produkte aus GVOs hergestellt wurden. Dabei ist nicht von Bedeutung, ob die GVOs in den Lebensmitteln nachweisbar sind. Die EU-Gesetzgebung gilt natürlich auch für Deutschland, jedoch sind viele Details durch das deutsche Gentechnikgesetz strenger geregelt als von der EU vorgegeben.

Wo steckt Gentechnik drin?
Kaufe ich schon heute im Supermarkt gv-Obst und Gemüse? Die Antwort lautet ganz klar: Nein! Pflanzen, die direkt zum Verzehr dienen, sind in Deutschland heute nach wie vor gentechnik-frei. Anders steht es um Fertigprodukte, in denen eine Vielzahl von Pflanzenstoffen verarbeitet wurde. Beispielsweise enthalten viele Lebensmittel Zutaten aus Soja-Rohstoffen: Öl in Margarine, Lecithin in Schokolade, Keksen und Eis, Sojaeiweiß in Fertigprodukten oder aus Sojabohnen extrahiertes Vitamin E.
Die EU führt jährlich etwa 70 Prozent ihres Sojabedarfs aus Ländern wie den USA und Argentinien ein. Dort werden gv- und herkömmliche Sojabohnen nicht von einander getrennt. Die Folge: Es ist davon auszugehen, dass alle Produkte, die aus Sojabohnen gewonnen werden, zu einem gewissen Anteil aus gv-Sorten stammen. Ähnliches gilt für Mais, der in Form von Stärke als Traubenzucker oder Glukosesirup besonders in süßen Produkten enthalten ist. Vor allem bei importierten Waren muss auch hier damit gerechnet werden, dass sie zumindest teilweise aus gv-Mais stammen.
In der EU müssen heute Produkte klar mit dem Hinweis "gentechnisch verändert" gekennzeichnet werden, wenn der Anteil an gv-Rohstoffen an der Gesamtmenge über 0,9 Prozent liegt. Heute wird dieser Schwellenwert nur sehr selten überschritten.
Gentechnik in tierischen Produkten
Soja, Mais und Raps dienen hauptsächlich als Futtermittel. Und ohne den Import großer Mengen an Futtermitteln wäre die Fleischerzeugung in der EU auf derzeitigem Niveau nicht möglich. So hält die Gentechnik über den Umweg der tierischen Produkte Einzug in die Supermärkte. Wissenschaftliche Untersuchungen mehrerer Länder zeigten, dass gv-Futtermittel in den Endprodukten - also Fleisch, Milch und Eier - nicht nachweisbar sind.
Doch der Verbraucher sollte sich auch über indirekte Gentechnik in tierischen Produkten informieren können. In Zukunft können in Deutschland tierische Erzeugnisse als "gentechnikfrei" gekennzeichnet werden, wenn die Tiere über einen gewissen Zeitraum mit konventionellen Futtermitteln gefüttert wurden.
Viele große Lebensmittelhersteller können und wollen nicht auf gv-Futtermittel verzichten. Andere Hersteller wiederum geben dem Druck der deutschen Konsumenten - die gv-Produkten gegenüber mehrheitlich skeptisch eingestellt sind - nach und achten auf eine gv-freie Herstellung tierischer Produkte.

Versteckte Gentechnik in Zusatzstoffen
Was bleibt, sind Zusatzstoffe und Enzyme, die mithilfe von gv-Mikroorganismen gewonnen werden. Bedeutend sind hier Aminosäuren, die als Futtermittelzusatz oder Geschmacksverstärker (Glutamat) eingesetzt werden, sowie Vitamine (V12, V2, VC). Die gewonnenen Zusatzstoffe werden jedoch gereinigt, enthalten daher keine Reste der gv-Mikroorganismen und sind somit durchaus als gesundheitlich unbedenklich einzustufen. Diese Stoffe werden auch zukünftig nicht kennzeichnungspflichtig sein.
Wer sich als Verbraucher gegen Gentechnik entschieden hat, dem ist zu raten, auf Lebensmittel mit dem Europäischen Biosiegel bzw. Lebensmittel der Bio-Anbauverbände zurückzugreifen. Für Bio-Produkte ist Gentechnik tabu. Zufällige Verunreinigungen sind aber auch hier nicht ganz auszuschließen. Gv-Mais muss beispielsweise zukünftig mindestens 300 Meter von Bio-Mais entfernt angepflanzt werden. Studien ergaben, dass so ein Anteil von 0,1 Prozent gv-Mais in Bio-Mais enthalten sein kann. Es wird für Verbraucher trotz Öko-Siegel also immer schwerer, sich vollkommen gentechnik-frei zu ernähren.
Für den Verbraucher ist es schwer, nicht mit gentechnisch veränderten Produkten in Berührung zu kommen. Doch die meisten Deutschen wollen keine Gentechnik in Lebensmitteln. Die Weichen für den zukünftigen Umgang mit der grünen Gentechnik werden heute gestellt.