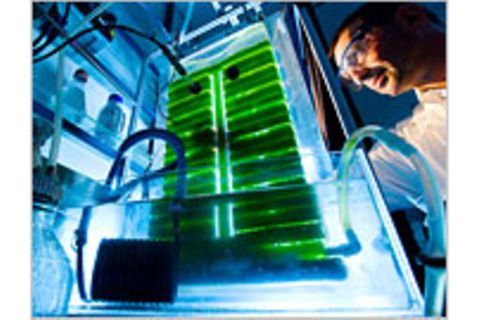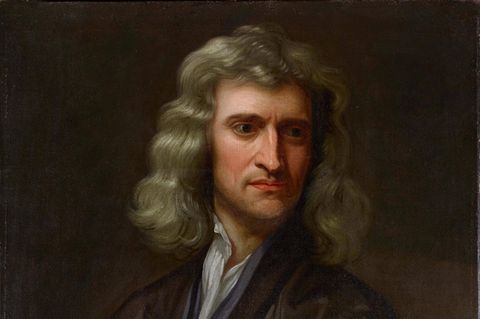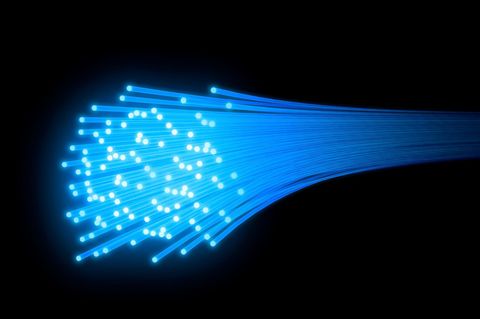Vögel
Auf der Erde wird es nachts immer heller - das beeinträchtigt den Lebensrhythmus, das Orientierungsvermögen von Säugetieren, Insekten, Amphibien, Reptilien und Vögeln - zum Teil mit tödlichen Folgen. Denn 30 Prozent der Wirbeltiere und 60 Prozent der wirbellosen Arten sind nachtaktiv. Sie haben sich im Lauf der Evolution an ein Leben in der Finsternis angepasst und werden erst munter, wenn es dämmert. Und: Die Beleuchtung stört sogar tagaktive Tiere. Sie verwechseln Kunst- mit Sonnenlicht und wachen viel zu früh auf. Bei den folgenden fünf Tiergruppen haben Forscher Änderungen der Lebensweise durch Licht zur Unzeit nachgewiesen. Was dies für den Fortbestand der Art oder die Stabilität des Ökosystems bedeutet, ist noch nicht klar.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wirklich?
Das Lied der Singvögel markiert gewöhnlich den Beginn des Tages, die Helligkeit ist der Auftakt zum Konzert. Doch manch städtisches Amselmännchen beginnt in tiefer Nacht zu singen - vermutlich verwechselt es das Licht der Straßenlaternen mit der Morgendämmerung.
Der Gesang zum falschen Augenblick hat komplexe Folgen, das haben Forscher des Max-Planck- Instituts für Ornithologie in Seewiesen an Blaumeisen gezeigt. Eigentlich sind Frühaufsteher oft besonders kräftige Tiere und haben bei der Paarung die besten Chancen: Wer früh losschmettert, verspricht Qualität als Partner. Wenn aber ein Irrläufer, den schon das Licht einer Straßenlaterne zum Zwitschern animiert, zu einem begehrenswerten Liebhaber wird, gerät die natürliche Selektion durcheinander. Außerdem neigen Weibchen unter Kunstlicht dazu, ihre Eier früher zu legen. Die hungrigen Jungen schlüpfen dann zu einem Zeitpunkt, zu dem das Angebot an Futter noch nicht ausreicht.
Falsche Sterne locken in den Tod
Hohe, erleuchtete Gebäude ziehen Zugvögel auf ihren saisonalen Wanderungen geradezu magisch an. Denn auf der nächtlichen Reise navigieren die Tiere unter anderem mithilfe des Sternenhimmels - die Lichtkuppel über einem rundum illuminierten Gebäude bringt sie dann schon einmal vom Kurs ab. Das Rotkehlchen zum Beispiel nutzt für die Navigation auch das Magnetfeld der Erde, das es mit Pigmenten im Auge erkennt. Farbiges Licht stört diese Wahrnehmung, die Orientierung geht verloren und die Tiere kollidieren mit dem Bauwerk.
In den USA kommen so Jahr für Jahr Millionen Zugvögel um. Ein Hochhaus in Deutschland ist als Vogelfalle besonders gut erforscht: Die Bonner Zentrale der Deutschen Post, ein über 160 Meter hoher, nachts vielfarbig strahlender Büroturm. In gut einem Jahr prallten dort, vor allem während des Herbstzugs, 827 Vögel gegen die gläserne Fassade - mehr als ein Viertel davon Rotkehlchen. Etwa jedes fünfte Tier überlebte den Sturz nicht.

Nur der Himmel weist den Weg
Sobald sich eine Meeresschildkröte aus ihrem Ei gekämpft hat, orientiert sie sich an der dunklen Silhouette der nächtlichen Dünenlandschaft. Von ihr wendet sie sich ab - und findet so das Meer, in dem sich Sterne und Mond spiegeln. Wenn aber eine glitzernde Promenade die Küste säumt, verlieren die frisch geschlüpften Tiere diese Orientierung. Sie laufen im Kreis, schlimmstenfalls kriechen sie in Richtung Licht (und damit manchmal Richtung Straße) und erreichen das schützende Meer nicht. Dieses Risiko ist gründlich erforscht. An vielen Stränden Floridas leuchten inzwischen besondere Straßenlaternen: Lichtfilter oder Leuchtdioden führen weniger Schildkröten in die Irre.
Die im Dunkeln frisst man nicht
Besonders empfindlich auf Kunstlicht reagieren Arten, deren Sinne perfekt an die Finsternis angepasst sind, etwa Frösche und Kröten. Sie sind fast ausnahmslos nachtaktiv und jagen Insekten im matten Glanz von Mond und Sternen. An erhellten Stellen, zum Beispiel unter einer Straßenlaterne, sind die Tiere jedoch einer sehr viel höheren Lichtmenge ausgesetzt.
Bis das Froschauge sich derart krassen Helligkeitssprüngen angepasst hat, können Minuten oder gar Stunden vergehen, besonders beim Wechsel vom Hellen ins Dunkle. Die Amphibien beschränken ihr Jagdrevier daher häufig auf beleuchtete Stellen - wodurch sich das Beutespektrum verändert. Nächtliches Licht beeinflusst außerdem das Fortpflanzungsverhalten. Die Weibchen des südamerikanischen Túngara-Froschs etwa haben es in heller Umgebung bei der Partnerwahl besonders eilig: Um nicht Fressfeinden zum Opfer zu fallen, paaren sie sich mit Männchen, die sie unter normalen Umständen verschmähen würden.
Die fatale Liebe zur Laterne
Wie eifrig die Motte ums Licht schwirrt, ist sprichwörtlich. Der Grund dafür ist derselbe, der auch Zugvögel lockt: Die Tiere halten das Kunstlicht für den Mond. Plötzlich ist der weit entfernte Himmelskörper ganz nah, das überfordert das Navigationssystem der Insekten. Die Liebe zur Laterne kostet in einer durchschnittlichen deutschen Sommernacht hochgerechnet eine Milliarde Insekten (neben Nachtfaltern auch Käfer, Wanzen, Zikaden, Eintags- oder Köcherfliegen) das Leben. Licht saugt die Tiere geradezu aus der Landschaft; sie wird ärmer an Arten.
Einzelne Spezies aber bekommen dadurch die Chance, sich massenhaft zu vermehren. Das bringt die Ökosysteme aus dem Gleichgewicht, sie werden anfälliger. Für Fressfeinde sind desorientierte Falter und Fliegen ein Festmahl: Einige Fledermausarten haben längst herausgefunden, dass rund um Straßenlampen Futter im Überfluss flattert. Für diese Tiere hat die künstliche Beleuchtung also durchaus positive Folgen. Allerdings verdrängen die Profiteure möglicherweise die schlechter angepasste Verwandtschaft.
In Deutschland untersuchen Wissenschaftler seit 2009 im Forschungsverbund "Verlust der Nacht", welches Risiko von nächtlicher Beleuchtung für Tiere ausgeht. Franz Hölker vom Leibniz- Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin sagt: „Unsere Erkenntnisse können dazu beitragen, dass Städte ihre öffentliche Beleuchtung in der Nähe von Parks und Wäldern optimieren. Damit Tiere keinen Schaden nehmen.“
Licht aus!
Mehr über die Earth Hour 2013 auf den Seiten von WWF