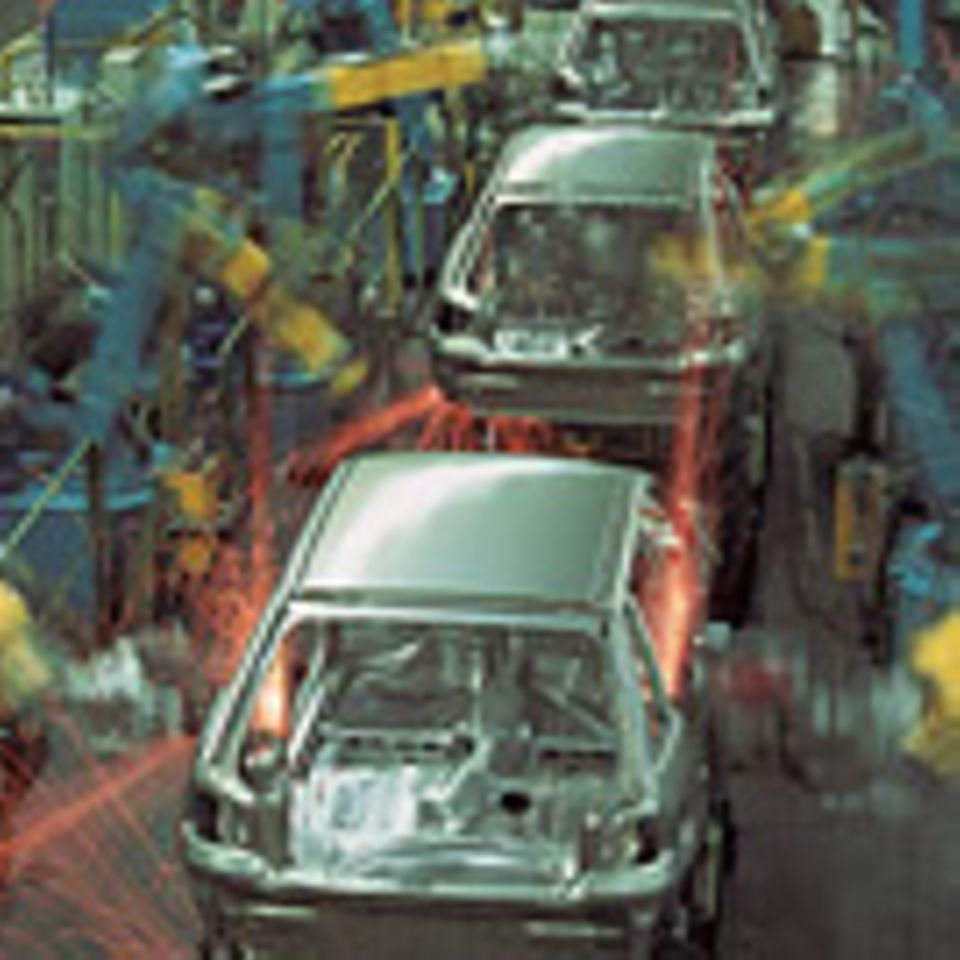Im April dieses Jahres trat der Chef des Umweltbundesamtes (UBA), Jochen Flasbarth, in Dessau-Roßlau mit einer frohen Botschaft vor die Presse: Der Ausstoß von Treibhausgasen sei in Deutschland im Jahr 2011 im Vergleich zu 2010 um zwei Prozent zurückgegangen. Und das trotz des Atomausstiegs. Und trotz eines Wirtschaftswachstums von rund drei Prozent. Die unausgesprochene Botschaft: Eine Klimagas-Reduktion bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum ist möglich.
Ähnlich zuversichtlich gab sich im Mai die EU-Klimakommissarin Connie Hedegaard: "Emissionsrückgang und Wirtschaftswachstum können zusammengehen", sagte sie bei einer Vorstellung der Ergebnisse des Emissionshandels. Der Handel mit Verschmutzungsrechten trage erste Früchte. Noch optimistischer meldete sich Klaus Töpfer zu Wort, einer der renommiertesten Umweltexperten Deutschlands. Er sagte jüngst in einem Interview mit der "Frankfurter Rundschau": "Wachstum und Umweltbelastung" - und dazu gehören neben den Klimagasemissionen etwa auch die Abfallproblematik und Flächenverbrauch - "können entkoppelt werden."
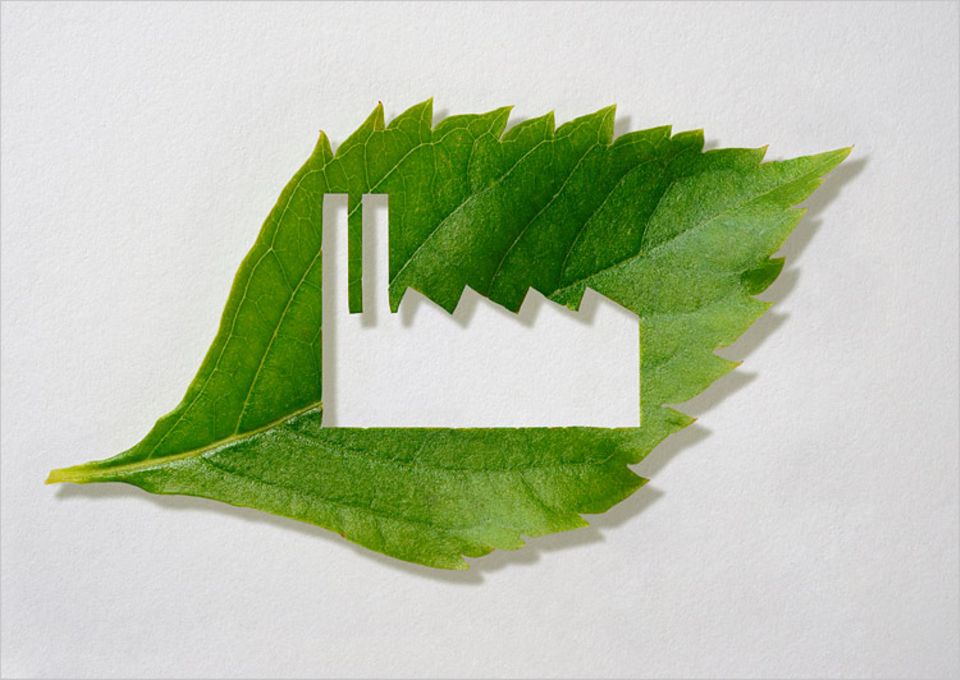
Entkopplung meint in diesem Zusammenhang: Das Wachstum der Wirtschaft führt nicht zu einem entsprechenden Wachstum der Umweltbelastung. So halten die Anhänger der "Green Growth"-Idee eine "grüne" Wirtschaft für möglich, in der das Bruttoinlandsprodukt steigt, die Umweltschäden aber gleichzeitig abnehmen. Und zwar dank moderner Technologien für mehr Rohstoff- und Energie-Effizienz und dank konsequenten Recyclings. Doch an genau diesem Punkt - ist Entkopplung überhaupt möglich? Und wenn ja, in welchem Maße? - entzündet sich heute eine hitzige Debatte.
Wirtschaftswachstum um jeden Preis?
Längst steht das Wirtschaftswachstum - Kritiker würden sagen: das Dogma des Wirtschaftswachstums - unter dem Verdacht, nur um den Preis immer größerer Umweltschäden zu haben zu sein. Selbst dann, wenn das Wachstum "grün" ist: "Es ist keineswegs ausgemacht, dass wir mit grünem Wachstum alle Probleme werden lösen können", sagt Karin Holm-Müller vom Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen (SRU). Gerade hat das siebenköpfige Gremium dem neuen Umweltminister Peter Altmaier das neueste Umweltgutachten übergeben. "Es kann sein", sagt Holm-Müller, "dass man in Bereichen wie CO2-Emissionen über eine Umstellung des Energiesystems sehr weit entkoppeln kann. Das heißt aber noch nicht, dass dies auch insgesamt möglich ist."
Im Konjunktiv formulieren auch andere Experten: "Die absolute Entkopplung ist möglich" - so der Titel eines Artikels des Ökonomen Raimund Bleischwitz über sein Forschungsprojekt "Makroökonomische Modellierung von Nachhaltigkeit, Umwelt und Wirtschaft in Europa". Absolute Entkopplung, das ist nach der Definition der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eine Umweltauswirkung, die konstant bleibt oder abnimmt, während die Wirtschaftsleistung steigt. Auch relative Entkopplung ist denkbar, bei der die Umweltbelastung zwar zunimmt, aber nicht im gleichen Maß wie die Wirtschaftsleistung.
Exportierte Umweltverschmutzung
Einige der wichtigsten Probleme bei der Berechnung der Entkopplung, oder der Modellierung, wie Forscher sagen, hat Bleischwitz in seinem Projekt untersucht: Wie lässt sich darstellen, dass Umweltbelastungen zunehmend ins Ausland verlagert werden, während die importierten Güter oder Dienstleistungen hierzulande auf das Bruttoinlandsprodukt einzahlen? Wie lassen sich sogenannte Rebound-Effekte berücksichtigen, die Effizienzsteigerungen durch Markteffekte wieder zunichte machen können? Und in welchem Ausmaß entkoppeln so unterschiedliche Sektoren wie Ressourcenverbrauch oder Flächennutzung?
Sein Fazit: "Der Energie- und Ressourcenverbrauch ist in der Mehrzahl der Länder vom Bruttoinlandsprodukt entkoppelt." Die Frage sei also nicht, ob Entkopplung möglich sei, sondern ob die laufenden Entkopplungsprozesse ausreichen. Notwendig sei nämlich eine Reduktion der CO2-Emissionen um 80 oder 90 Prozent. "Mit Technologien, die schon entwickelt oder in der Pipeline sind, können wir sehr viel erreichen", meint Bleischwitz. Allein auf technischen Fortschritt zu vertrauen, hält er jedoch für gewagt.
Zudem liege der Fokus der Forschung noch zu einseitig auf den CO2-Emissionen, bemängelt Bleischwitz, der am Wuppertal Institut stellvertretend die Forschungsgruppe Ressourcenmanagement und Stoffströme leitet. Nötig sei ein Ansatz beim globalen Materialaufwand, also eine ganzheitliche Betrachtung aller Ressourcen. Kritisch merkt auch Karin Holm-Müller an, dass etwa die Flächennutzung "sicher nicht entkoppelt" sei. Zu den Gründen dafür zählt gerade diejenige Energieform, der nach fast einhelliger Meinung die Zukunft gehört. "Man darf nicht vergessen, dass die erneuerbaren mehr Fläche brauchen als die fossilen Energien", sagt Holm-Müller.
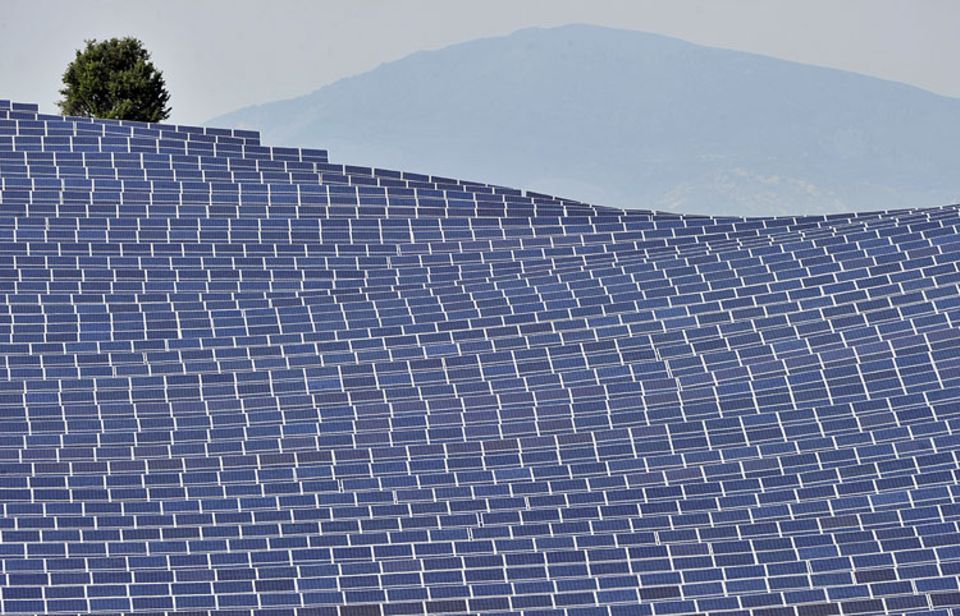
Empfehlungen für die Politik
Einig sind sich die beiden darüber, dass mehr staatliche Anreize zum Energiesparen und zur Ressourcenschonung gegeben werden müssen. So schlägt Bleischwitz etwa eine Besteuerung von Baustoffen in Höhe von zwei Euro pro Tonne vor. Darüber hinaus fordert er ein international ausgerichtetes Vorgehen. Denn nationale Entkopplung nütze wenig, wenn andere Länder nicht mitziehen. So sei es etwa denkbar, dass der Preis für Rohstoffe und Energieträger international sinke, wenn dank der Effizienzgewinne in Deutschland oder der EU weniger verbraucht werde. Das könnte andere Staaten dazu anregen, die eigene Nachfrage zu steigern. Um solche unerwünschten internationalen Rebound-Effekte zu vermeiden, schlägt Bleischwitz eine "Dämpfung der Nachfrage durch ökonomische Anreize" vor.
Doch um an ein international abgestimmtes Vorgehen zu glauben, sagt Bleischwitz, brauche man schon ein gehöriges Maß an Optimismus. "Reicht das, was wir an politischem Willen sehen, um die Entkopplung zu erreichen? Ich fürchte, nein."
Doch fehlt es wirklich nur am politischen Willen, um die Entkopplung zu erreichen? Ist nicht vielleicht das Festhalten am Paradigma des unendlichen Wirtschaftswachstums das Problem? Vorsichtig gibt Raimund Bleischwitz zu bedenken: "Es kann gut sein, dass man am Ende zwar viele positive wirtschaftliche und Umwelt-Ergebnisse erzielt hat, dass aber die Wachstumsraten nicht mehr spektakulär hoch sind." Deutlicher wird Karin Holm-Müller: "Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir vom Wachstum unabhängiger werden können." Als Beispiel nennt sie: die Postwachstumsgesellschaft.
Ist das Wirtschaftswachstum am Ende?
Einer der Vordenker der Gesellschaft ohne Wachstum ist Niko Paech von der Universität Oldenburg. Ihm ist jeder Optimismus fremd, der sich auf die Vereinbarkeit von Wachstum und Umwelt bezieht. Im Gegenteil: Wortgewandt und angriffslustig drischt er verbal auf die Verteidiger eines Wachstums im grünen Gewand ein. Die Entkopplungstheorie hält er schlicht für die "Quadratur des Kreises".
"Eine relative Entkopplung bedeutet keine Entlastung, sondern eine zusätzliche Belastung der Ökosphäre", sagt Paech. Und deren Belastbarkeit habe nun mal absolute Grenzen. Zudem werde von den Theoretikern der Entkopplung nicht ausreichend thematisiert, dass die Kosten für eine zerstörte Einheit des Naturkapitals nicht konstant seien - sondern mit zunehmender Verknappung exponentiell steigen können. So seien etwa die Kosten für einen versiegelten Hektar Land im Deutschland der Nachkriegszeit wesentlich geringer gewesen als heute. Die Folge: "Wir können nicht ausschließen, dass die Kosten, die wir für eine zusätzliche Umweltbelastungseinheit veranschlagen müssen, schneller steigen als es der wachsenden Wirtschaft gelingt, den Schaden pro Wachstumseinheit zu reduzieren."
Paech sieht noch weitere Fallstricke in der Theorie der Entkopplung. "Wenn man Häuser mit Dämmstoffen dämmt, die extrem hohe Formaldehydemissionen aufweisen und gesundheitsschädlich sind - wie soll man das gegenrechnen? Oder wenn die Abfälle nicht zu entsorgen sind? Was passiert, wenn die erste Generation von Photovoltaikmodulen entsorgt werden muss?", fragt er.
Absolute Entkopplung: ein Hirngespinst?
Für noch unrealistischer hält der Ökonom die absolute Entkopplung. Er illustriert seine Skepsis am Beispiel der erneuerbaren Energien, einem der Motoren des "grünen" Wachstums: "Sind erst einmal die Kapazitäten der erneuerbaren Energieerzeugung aufgebaut, findet in diesem Bereich kein nennenswertes Wirtschaftswachstum mehr statt. Denn dann wären ja nur noch Reparaturarbeiten fällig." Außerdem müssten, um Rebound-Effekte zu vermeiden, die Kapazitäten der konventionellen Energieerzeugung abgebaut werden. Und zwar im selben Maß, wie die Erneuerbaren ausgebaut werden.
Wird etwa ein Windpark in der Nordsee errichtet (für Paech ist das an sich schon ein "immenser ökologischer Schaden"), so müssen der erzeugten Energiemenge entsprechend Atommeiler und Kohlestrom-Kraftwerke rückgebaut werden. Deren Abriss kostet Energie. Und bedeutet einen Verlust an Unternehmensgewinnen, Steuern und Arbeitnehmereinkünften. "Wie soll sich das unter dem Strich zu einem Wachstum addieren?", fragt Paech. Sein Fazit: "Die eigentliche Leistung der Entkopplungstheorie besteht in der Entkopplung zeitgenössischer Wohlstandsexzesse von kritischer Reflexion." An einem umfassenden gesellschaftlichen Wandel weg von der Wachstumsorientierung führt nach seiner Auffassung kein Weg vorbei.
Bei aller Uneinigkeit: Die Debatte über die Umweltauswirkungen des Wirtschaftswachstums ist angestoßen. Aber noch scheint sie die Regierungskreise nicht erreicht zu haben. Trotz des fortschreitenden Klimawandels, trotz anhaltender Finanzkrise, trotz schlechter Aussichten für konkrete Erfolge der RIO+20-Konferenz. Allzugern hört man in Berlin und anderswo noch Botschaften wie die vom Chef des UBA, Jochen Flasbarth.
Übrigens korrigierte die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen die UBA-Daten bald nach deren Bekanntgabe: Verantwortlich für den Rückgang der CO2-Emissionen sei vor allem die milde Witterung gewesen. Temperaturbereinigt sei immer noch ein Anstieg von 0,8 Prozent zu verzeichnen.