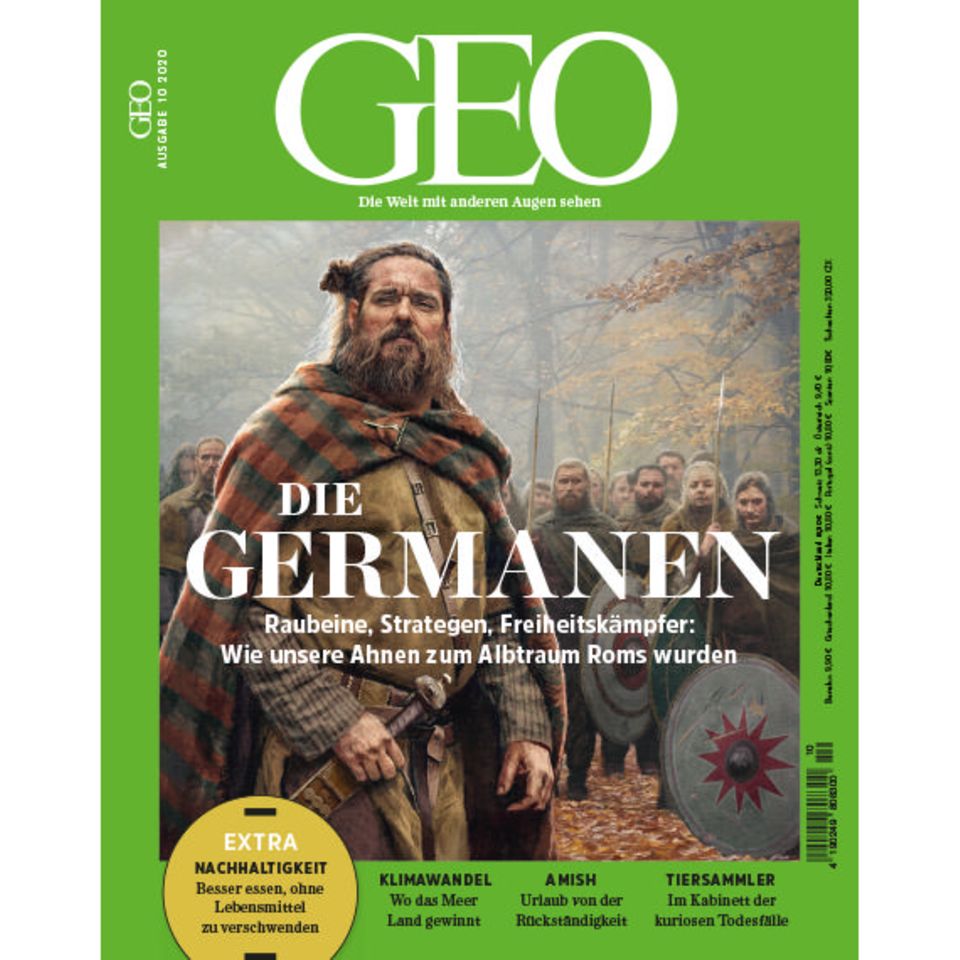Orangen sind eigentlich nicht orange. Ihre Schalenfarbe verrät nichts darüber, wie reif und saftig das Innere ist. In China und Südostasien, woher die Zitrusfrucht ursprünglich stammt, wird sie heute noch dunkelgrün verkauft. Doch als genuesische Seefahrer den „chinesischen Apfel“ im 15. Jahrhundert nach Europa brachten und besonders Bauern in Portugal die Apfelsine anzubauen begannen, verfärbte sich ihr Äußeres: Die kälteren Nächte Europas ließen das grüne Chlorophyll schwinden und den Anteil der rotorangefarbenen Carotinoide in der Schale ansteigen.
Die Europäer gewöhnten sich an die leuchtende Farbe: Selbst wenn Orangen nach einem warmen Frühherbst zwar längst reif, aber noch grün sind, wären sie heute unverkäuflich. Daher helfen viele Bauern nach: Sie setzen die Früchte Ethen (Ethylen) aus, bevor diese in den Verkauf gehen. Das Reifegas ist ein pflanzliches Hormon und stößt die Orangewerdung an.
Auch Bananen kaufen wir nur, wenn sie die richtige Farbe haben. Deswegen wird auch bei Bananen, wie bei Mangos und Tomaten, mit Ethen nachgeholfen, was die meisten Verbraucher nicht ahnen. Und das ist besser so: Wüssten sie, dass ihre Vitaminbomben „künstlich begast“ wurden, würden sie vielleicht nicht mehr zugreifen – und das Obst landete im Müll.
Die Beispiele zeigen: Was wir essen oder verschmähen, einkaufen oder liegenlassen, in die Obstschale legen oder in die Tonne treten, ist nicht immer rational nachvollziehbar. Eine fein abgestimmte Maschinerie ist darauf ausgerichtet, uns mit stets frischen, appetitlichen Lebensmitteln zu verführen. Trotzdem werden zum Beispiel allein in Großbritannien an einem einzigen Tag 1,4 Millionen essbare Bananen weggeschmissen.
Diese Dimensionen waren mir zu Beginn der Recherche nicht bewusst: Rund ein Drittel der global produzierten Lebensmittel werden nie gegessen. Die vergebens produzierte Nahrung beansprucht riesige Ackerflächen, verbraucht in der Herstellung Unmengen an Wasser, Dünger und Arbeitskraft. Durch den überflüssigen Transport, die Kühlung und Verarbeitung verursacht sie so viele Treibhausgase, dass die Nahrungsvergeudung, wäre sie ein Staat, auf Platz drei der größten CO2-Produzenten landen würde – direkt hinter den USA und China.
Seit Jahren schwelen Proteste gegen die Vernichtung von Lebensmitteln. Die „Container“-Bewegung fischt Essbares aus Mülltonnen hinter Supermärkten. „Gurkenretter“-Initiativen prangern an, dass krumm gewachsenes Gemüse auf dem Acker liegen bleibt, weil Verbraucher dieses angeblich nicht haben wollten. Die Schuld scheint immer bei den anderen zu liegen: bei den Bauern, den Supermärkten, der Industrie.
Doch in Wahrheit sind wir Verbraucher für rund 50 Prozent der Verschwendung in westlichen Ländern verantwortlich. Und selbst dabei sind die Dinge komplexer, als ich zunächst angenommen hatte. Die erste überraschende Erkenntnis:
Wer sich gesund ernährt, verschwendet oft viel
Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüsse – eine gesunde Ernährung scheint zunächst auch gut für den Planeten zu sein. Doch Zach Conrad, ein Ernährungs-Epidemiologe aus den USA, hat in einer 2018 erschienen Studie mahlzeitengenau nachgerechnet: Wer sich hochwertig ernährt, vergeudet oft mehr Nahrungsmittel. Im Abfall landen vor allem Gemüse und Obst, deren Herstellung viel Wasser und Pestizide verbraucht.
Bei Menschen, die gern Fertigprodukte essen, fällt die Verschwendung auf einer anderen Ebene an: bei den Herstellern. Diese machen aus Reis, Gemüse und Fleisch ganze Mahlzeiten, und auch da kommt es bei der Anlieferung, dem Schneiden, Kochen oder Verpacken zu Verlusten. Die Produzenten sind jedoch – anders als die Verbraucher – gut darin, ihren tatsächlichen Bedarf abzuschätzen und den Verarbeitungsprozess zu optimieren. Im Verhältnis zur Gesamtmenge vergeuden sie weniger als Haushalte.
Wer es dagegen gut mit sich und anderen meint, indem er selbst frisch und abwechslungsreich kocht, kauft viele verschiedene Produkte ein, versucht sich an aufwendigen Gerichten – und lebt anfälliger für Verschwendung. Das hat auch der Soziologe David Evans bei seinen Feldforschungen im Süden Manchesters beobachtet: „Durch die Bereitstellung von ‚richtigem Essen‘ zeigt man – so die allgemeine Überzeugung –, dass einem die anderen am Herzen liegen. Dieses Dogma sorgt allerdings dafür, dass wir in unseren Haushalten überschüssige Lebensmittel horten.“