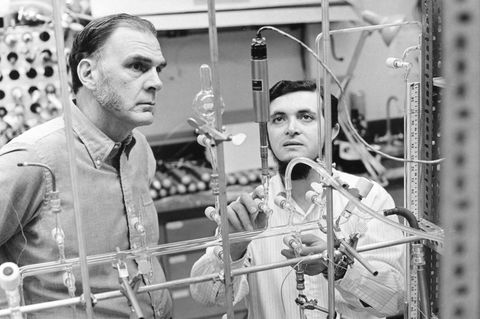Was bedeutet "klimaneutral"?
"Klimaneutral" bedeutet zunächst einmal: ohne negativen oder positiven Einfluss auf das Klima. Da es kein Produkt, keinen Industriezweig gibt, der überhaupt keine Emissionen verursacht, sei es bei der Herstellung oder beim Transport, ist die Idee: In einem ersten Schritt sollen Emissionen in der Produktion so weit wie möglich reduziert werden. Der (vorerst) unvermeidliche Rest wird kompensiert.
"Klimaneutral" wollen übrigens nicht nur Unternehmen sein – Deutschland will das Ziel bis zum Jahr 2045 erreicht haben, die Europäische Union bis zur Mitte des Jahrhunderts.
Was mit "Kompensation" gemeint?
Kompensation bedeutet so viel wie "Wiedergutmachung". Im Kontext der Bemühungen um die Verringerung klimaschädlicher Emissionen ist damit zum Beispiel gemeint: Personen oder Unternehmen kaufen Bescheinigungen darüber, dass irgendwo auf der Welt eine bestimmte Menge Kohlenstoffdioxid gebunden, Emissionen vermieden wurden – so genannte CO2-Zertifikate. Viele, die klimabewusst(er) fliegen wollen, kennen das als freiwillige Kompensation der Flug-Emissionen, zum Beispiel über atmosfair. Die Idee: Dem Klima ist es ja egal, wo auf der Erde Emissionen anfallen oder der Atmosphäre entnommen werden. So werden zum Beispiel durch die finanzielle Unterstützung eines Wiederaufforstungsprojekts im Brasilien die restlichen, nicht vermeidbaren Emissionen eines Produkts "neutralisiert".
Kritiker des Kompensations-Modells geißeln das Geschäft mit den Zertifikaten ganz grundsätzlich als "Ablasshandel": Gegen einen geringen Aufpreis gibt es ein "reines" Gewissen. Zudem halten manche Experten Wiederaufforstungs- oder Waldschutzprojekte für ungeeignet. Schließlich kann niemand genau vorhersagen, wie viel CO2 ein Wald innerhalb eines bestimmten Zeitraums tatsächlich bindet. Schlimmer noch: Die Bäume könnten auch einem Sturm zum Opfer fallen oder bei einem Waldbrand in Flammen (und CO2) aufgehen.
Befürworter der Kompensationen halten dem entgegen, dass durch den Handel mit Zertifikaten Geld in nachhaltige Projekte in Entwicklung- und Schwellenländern fließt. Zudem steigere das Modell sowohl in Unternehmen als auch bei Privatpersonen das Bewusstsein für die eigene Klimaverantwortung. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Projekte durch unabhängige Stellen zertifiziert sind und einen zusätzlichen Nutzen haben. Es darf sich also zum Beispiel nicht um Flächen handeln, die ohnehin aufgeforstet worden wären.
Was ist echter Klima-Nutzen, was Greenwashing?
Um das Konzept der Klimaneutralität gab und gibt es eine kontroverse Debatte. Kritiker meinen, dass selbst offenkundig klimaschädliche Produkte gegen einen geringen Aufpreis als "klimaneutral" verkauft werden können – und damit auch für Konsument*innen attraktiver (weil klimafreundlicher) wirken können, als sie tatsächlich sind. Ein Beispiel ist "klimaneutrales" Heizöl. Da der Rohstoff klimaschädlich gefördert, raffiniert, transportiert und verbrannt wird, beruht die behauptete "Klimaneutralität" in diesem Fall einzig und allein auf der Kompensation. Entscheidend ist in jedem Fall die tatsächliche Bemühung eines Unternehmens um Vermeidung oder Verringerung der Emissionen in der Produktion.
Ein weiteres Problem ist der enge Fokus auf das Klima. Fast jedes Produkt hat weitere Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die in der Klimabetrachtung gar nicht auftauchen. Zum Beispiel die Gewinnung von seltenen Erden unter menschenunwürdigen Bedingungen. Ein "klimaneutrales" Produkt muss also nicht auch "umweltfreundlich" und "fair" sein – und umgekehrt.
Wofür sind "CO2-Äquivalente" gut?
Kohlenstoffdioxid, also CO2, ist zwar das wichtigste Gas, das das Klima negativ beeinflusst – aber bei Weitem nicht das einzige. Methan zum Beispiel (CH4) gelangt zwar in geringerer Menge in die Atmosphäre, etwa aus der Landwirtschaft oder aus der Produktion fossiler Energien, ist aber weitaus klimaschädlicher als CO2. Für die Bilanzierung ist es also wichtig, alle Klimagase vergleichbar zu machen und zusammenzufassen. Dafür wird die Klimawirkung anderer Gase umgerechnet auf die von CO2. Ein Beispiel: Auf einen Zeithorizont von 100 Jahren ist eine Tonne Methan genauso schädlich wie 28 Tonnen CO2. Entsprechend wird die Tonne Methan mit 28 Tonnen CO2e (CO2-Äquivalenten) bilanziert.
Was bedeutet "klimapositiv"?
Ein Produkt, das "klimapositiv" sein soll, hat sogar einen positiven Einfluss auf das Klima – so das Versprechen. Erreichen lässt sich das relativ einfach – durch den Kauf von mehr CO2-Zertifikaten. Übersteigt die Menge der Zertifikate die verbliebenen Emissionen, ist ein Unternehmen oder ein Produkt – rein rechnerisch – klimapositiv. Ein Beispiel ist der Babynahrung-Hersteller Hipp: Pro Glas werden nach Unternehmensangaben im Schnitt 319 Gramm CO2 erzeugt, kompensiert werden aber 350 Gramm.