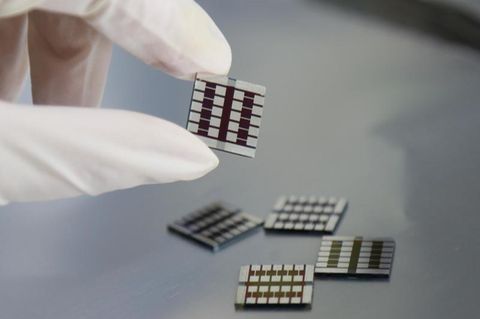Energiegewinnung aus Biomasse ist im Kommen - hat aber ein Imageproblem. Die Einführung des Biosprits E10 floppte nicht nur, weil die Akzeptanz der Autofahrer fehlte. Schnell wurde auch Kritik laut, dass der großflächige Anbau der Energiepflanzen, etwa Mais oder Zuckerrohr, zu höheren Nahrungsmittelpreisen und Hunger führe. Davor warnte schon 2008 eine Studie der Weltbank. Damit wäre die Klimafreundlichkeit dann doch zu teuer erkauft. Hinzu kommen weitere Probleme. So sorgen in Deutschland "vermaiste" Landstriche zunehmend für Unmut: Der großflächige Anbau von Mais zur Biogasgewinnung führt zu Bodenverarmung, hohen Pestizidbelastungen und Artenschwund.
An umweltverträglichen Alternativen wird längst geforscht. Eine von ihnen könnte in einer glibbrigen, quietschgrünen Masse liegen, mit der Mandy Gerber und ihr Kollege Sebastian Schwede von der Ruhr-Universität Bochum forschen: einzellige Meeresalgen. Die Umweltingenieurin und der Biologe untersuchen, inwieweit sich die Mikroalgen zur Gewinnung von Biogas eignen. Erste Ergebnisse sind vielversprechend.

Meerwasser-Algen wie Nannochloropsis salina sind für die Biomasseproduktion interessant, weil jede einzelne Zelle Photosynthese betreibt und die Biomasse bis zu zehn Mal schneller wächst als bei Landpflanzen. Zudem steht ihr Anbau nicht, wie bei vielen Energiepflanzen, in direkter Konkurrenz zum Anbau von Nutzpflanzen für die Nahrungsmittelherstellung. "Algen eignen sich", sagt Mandy Gerber, "nicht nur als sortenreines Gärsubstrat, sondern auch als Beimischung zu anderer Biomasse". Wenn man etwa Mais mit Algen mischt, erhält man eine höhere Gas-Ausbeute als in der sogenannten Mono-Vergärung. Denn die Spurenelemente der Algen beschleunigen und intensivieren den Gärprozess.
Züchten ließe sie sich an geeigneten Standorten in Teichen. Platzsparender ist allerdings der so genannte Photo-Bioreaktor, eine Art Gewächshaus, in dem die Algen in Süß- oder Salzwasser gedeihen.
Solche Anlagen gibt es schon. Etwa auf dem Gelände des Braunkohle-Kraftwerks Niederaußem des Betreibers RWE. Hier züchtete die Firma Phytolutions in einer Versuchsanlage von 2008 bis 2011 Algen. "Gefüttert" wurden sie mit CO2 aus dem Abgas der Turbinen. Aus dieser Anlage bezog das Team um Mandy Gerber bislang die Algen für seine Forschung. Im Herbst 2011 eröffnete Vattenfall im brandenburgischen Braunkohle-Kraftwerk Senftenberg mit 50.000 Litern Fassungsvermögen die zweitgrößte Anlage ihrer Art.
Weitere solche Photo-Bioreaktoren könnten auf Industriebrachen oder in Wüsten entstehen. Wertvolles Ackerland bliebe unberührt. "Ideal wären Standorte mit Zugang zu Meerwasser und viel Sonne, etwa am Mittelmeer", sagt Mandy Gerber. In wasserarmen Gebieten könnte man den Wasserverbrauch durch Wiederaufbereitung minimieren. So ließen sich mehrere Generationen von Algen mit demselben Wasser züchten. Geerntet werden die Einzeller durch Zentrifugieren, Filtern, Ausflocken oder Sedimentieren. Zentrifugen, die auch in Niederaußem im Einsatz waren, haben allerdings den Nachteil, dass ihr Einsatz viel Energie verschlingt.

Die Zucht der Algen ist relativ unproblematisch. Doch bei der Effizienz ihrer Nutzung gibt es noch Forschungsbedarf. "Das Problem bei den Mikroalgen ist, dass sie eine sehr robuste Zellwand haben, darum können die Mikroorganismen die Zelle für die Biogasproduktion nicht ohne weiteres aufschließen", sagt Mandy Gerber. Darum arbeitet das Team zurzeit an Verfahren, die Zellwände zu "knacken" - mit Hitze, Kälte, Druck, Mikrowellen und Ultraschall. Immerhin: Nach acht Stunden Kochen auf kleiner Flamme ergab die Algensuppe eine um 50 Prozent höhere Gas-Ausbeute. Und selbst dieses relativ aufwändige Verfahren lieferte am Ende immer noch mehr Energie, als für das Erwärmen notwendig war.
Eine Perspektive sehen die Forscher der Ruhr-Universität Bochum in kombinierten Biodiesel-/Biogas-Anlagen. In einem ersten Gang würden die Fette aus den Algen extrahiert und zu Biodiesel weiterverarbeitet. Danach könnte aus der verbliebenen Biomasse Biogas gewonnen werden. Der Gärrest wiederum könnte als hochwertiger Dünger auf den umliegenden Äckern landen. Auf diese Weise wäre die Energieerzeugung nicht nur CO2-neutral, sondern entzöge der Atmosphäre einen Anteil des Klimagases dauerhaft. "Von zwei Tonnen CO2, die die Algen in Biomasse umgewandelt haben, bleiben 1,76 Tonnen nach der Vergärung fixiert im Gärrest", sagt der Biologe Sebastian Schwede. Der klimafreundliche Abfall könnte schließlich als wertvoller Dünger auf dem Acker landen.
Weitere Nebenprodukte sind in dieser Verwertungskette denkbar. So ließen sich aus geeigneten Algenarten vor der Vergärung Omega-3-Fettsäuren extrahieren, wichtige Zusatzstoffe für Nahrungsmittel, Kosmetika und Medikamente.