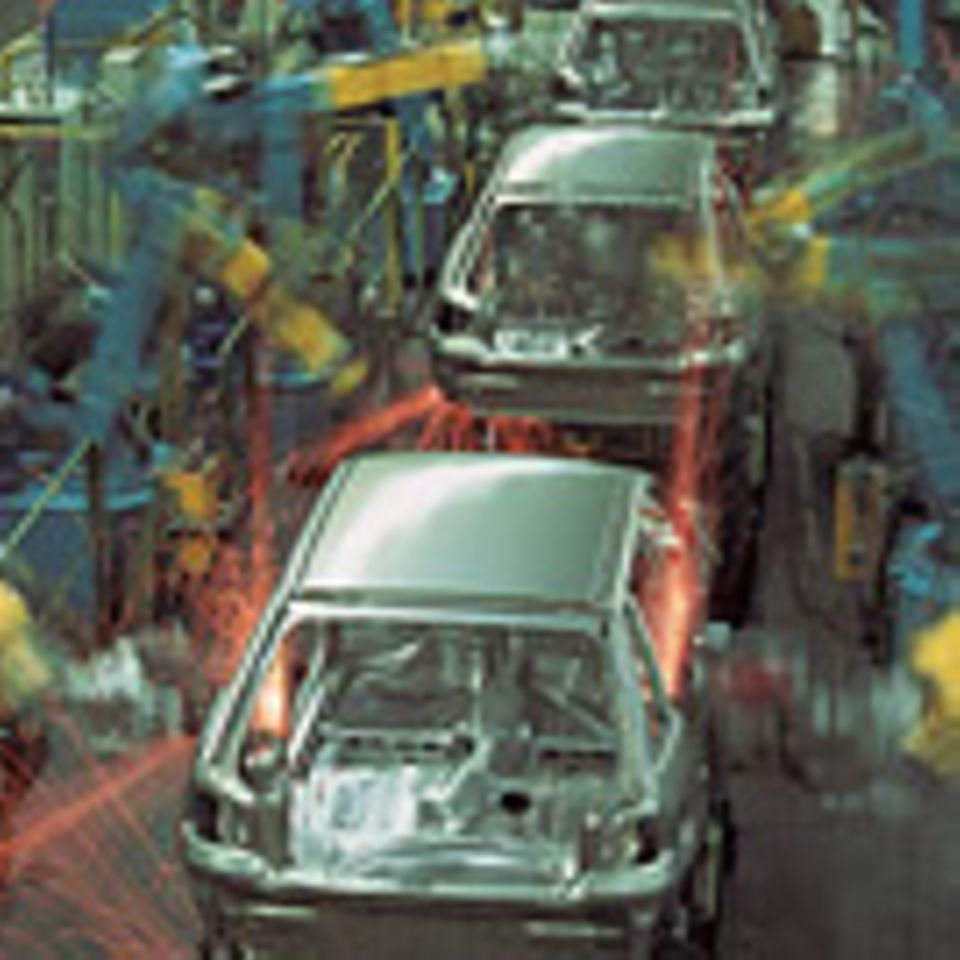GEO: Sie provozieren und sagen, das Wirtschaftsmodell des Westens habe abgedankt. Asien solle eine andere Zukunft initiieren, mit radikaler Ressourcenbeschränkung. Trotzdem werden Sie als Referent nach Davos eingeladen oder zum "Global Economic Symposium" in Kiel. Sind die Organisatoren so verzweifelt, dass sie Rat von Ketzern benötigen?
Chandran Nair: Diese Tagungen sind ein Versuch, einen anderen Gedankenaustausch zu starten. Da gibt es sehr nette Leute mit ernsthaften Intentionen. Aber sie sind ideologisch gefesselt. Die Ideologie vom freien Markt lässt den Menschen in der reichen Welt ja die Illusion, ihr Lebensstil sei in Ordnung, schließlich können die anderen ihn theoretisch auch erreichen. Westler verstehen einfach nicht das Maß und die Komplexität der Probleme anderswo. Auf den Konferenzen projizieren die Redner ihr in den Kleinstädten des Westens gesammeltes Wissen auf Delhi und Beijing und den Rest der Welt. Und referieren darüber, wie Menschen zu Software-Ingenieuren werden können.
Was spricht gegen Software-Ingenieure?
Wir haben in Asien inzwischen mehr Software-Ingenieure, als wir brauchen. Und, zum Beispiel in Indien, mehr Telefone als Toiletten. Die Business-Schulen lehren, dass Innovation, Technik und natürlich Demokratie die Probleme der Welt lösen. Das ist eine Lüge. Wir müssen einsehen, dass die Welt ein ziemlich überfüllter Platz ist und wir uns darin anders verhalten müssen. Aber kein Westler sagt den Asiaten: "You can’t have it, ihr könnt nicht alles haben." Man würde ihm Rassismus vorwerfen.

Nun wirken gerade China und Indien ja extrem wachstumsgetrieben und kapitalistisch. Und haben natürlich auch einen berechtigten Nachholbedarf beim Konsum.
Aber die fünf oder sechs Milliarden Asiaten, die es 2050 geben wird, können nicht wie Amerikaner leben. Wenn sie es tun, wird Asien die Welt zerstören.
Und wie soll der Westen Ihrer Meinung nach handeln, um eine lebenswerte Zukunft für alle zu garantieren?
Es mag für Sie seltsam klingen. Aber es ist relativ egal. Die Einwohner des Westens stellen bald nur noch zehn Prozent der Weltbevölkerung. Selbst wenn die USA und Europa erleuchtet würden und harte politische Entscheidungen fällten, würde das nichts nutzen, solange die Asiaten sagen: Tut uns leid, wir wollen unsere Party jetzt, weil ihr eure 200 Jahre lang gehabt habt.
Stattdessen wollen Sie die Party der westlichen Konzerne stören, die Asien als Zukunftsmarkt lieben.
Die 200 Jahre westlicher Dominanz beruhen auf dem Geschäftsmodell, die Ressourcen in der ganzen Welt zum Spottpreis zu bekommen. Die ganze Welt will "Made in China", billig. Die ganze Welt will das 500-Dollar-iPad. Warum wird es in China gemacht, nicht in Kalifornien? Weil die Hersteller wissen, dass sie dorthin die Kosten auslagern können.
Über das Thema "wahre Preise", also die Umweltkosten nicht auszulagern, sondern einzubeziehen, reden wir im Westen seit 40 Jahren, als die "Grenzen des Wachstums" erschienen. Bisher weitgehend ohne Folgen. Was wäre denn der "wahre" Preis eines iPad?
10.000 Dollar? Und wenn es 8000 wären, hätte ich immer noch recht. Ich habe einmal gesagt: "Der wahre Preis eines Hamburgers ist 100 US-Dollar." Vielleicht ja auch nur 75. Das Problem ist die völlige Verzerrung der Kalkulation. Das bisherige Geschäftsmodell ist: so billig wie möglich an so viele wie möglich zu verkaufen. Aber um das zu tun, muss man die Kosten auf die Allgemeinheit verlagern – und die Welt ruinieren.
Bisher ist das "Konzept billig" trotzdem heilig. Fortschritt, auch ganz persönlicher, definiert sich heute ja oft genug durch neue Computermodelle, schicke Sportschuhe und schnelle Autos. Am bisherigen Wirtschaftswachstumsmodell hängen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch unsere Vorstellungen vom Wohlstand.
Wenn ich in den USA sage, ein Auto sei kein Menschenrecht, bin ich dort eine Art Taliban. Aber Asien muss sich eine Zukunft vorstellen, in der die Städte nicht dem Autowahn des Westens nachgeben und in der immerwährendes Wachstum nicht als einziges Rezept für Wohlstand und politische Stabilität gilt. In den vergangenen 100 Jahren hatte der Autobesitzer einen Freifahrtschein. Morgen sollte es heißen: Ihr wollt ein Auto? Bitte sehr. Aber ihr dürft nicht mehr umsonst den öffentlichen Raum beanspruchen und die Städte zerstören und Fußgängern das Leben schwer machen. Ab sofort zahlt ihr für die Umweltzerstörung, für die Luftqualität. Mit dem Geld lassen sich Alternativen finanzieren, zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr.
Sie könnten Ehrenmitglied bei den Grünen werden.
Es gibt im Westen Menschen, die rational verstehen, dass es anders werden muss. Aber es ist billig zu sagen, dass man alle Wälder schützen soll, wenn man in Berlin oder Hamburg sitzt. Es können nicht alle Wälder geschützt werden. Was wir machen müssen, ist herauszufinden, wie wir so viel wie möglich schützen können in einer chaotischen Welt. Das will keiner hören. Bald werden wir zwei Milliarden mehr sein. Wir können nicht diesen zwei Milliarden Chinesen, Indern, Indonesiern und Afrikanern die grundsätzlichen Lebensrechte absprechen. Die Menschen brauchen nicht alle Autos und große Häuser und Waschmaschinen. Aber sie brauchen fundamentale Lebensrechte.
Wie definieren Sie die?
Wohlstand bedeutet für mich: Nahrungssicherheit. Wasser und Hygiene. Eine ordentliche Wohnung. Gesundheit. Und natürlich Bildung. Diese Menschenrechte. Sie für mehr Milliarden Menschen zu schaffen, wäre Grundlage der neuen Ökonomie.
Jeder Politiker wird da theoretisch Beifall klatschen ...
... und trotzdem einem Wirtschaftsmodell folgen, das diese Ziele nicht einlösen kann. Dieses Modell heißt: Macht den Kuchen größer, und wenn einige reich werden, wird schon für alle etwas abfallen. Aber das ist eine naive Idee, vorgetragen von einer der naivsten Mächte der Welt, den USA. Sie funktioniert nach der Logik: Lass uns heute die Wälder abholzen, damit wir morgen den Klimawandel bekämpfen können.
Also steht Verzicht im Raum, ein sehr unbeliebtes Wort!
Warum arbeiten unsere besten Köpfe daran, elektronisches Spielzeug billiger zu produzieren oder die Gewinne der Großbanken zu steigern, statt Strategien für den Umgang mit unserer kollektiven Zukunft zu erarbeiten? Bisher gilt das westliche Ökonomiemodell als eine Art universelle Wahrheit. Wir brauchen einen neuen Wissenskanon, in dem es um Gemeinwohl geht. Man ändert Gesellschaften durch neue Narrative, dadurch, dass man neue Dinge glaubt. Ich mache in Asien Werbung für ein Programm "100.000 PhDs": 100 000 Akademiker, die besten Wissenschaftler, sollten an Forschungsprogrammen arbeiten, die den konventionellen Denkweisen völlig andere entgegensetzen.
Um vorherzusagen, dass die Weltwirtschaft zusammenbricht, wenn faire Preise Wirklichkeit würden, braucht man kein Akademiker zu sein.
Das ist komplette Verängstigungstaktik. Sicher, es würde sich viel verändern. Aber wir wissen nicht, was passiert. Vielleicht wird Apple nicht zwei Millionen Billig-iPads verkaufen, sondern nur 100.000, aber für den korrekten Preis.
In Ihrem Buch "Der große Verbrauch" gibt es ein interessantes Gedankenspiel: China erhebt eine Kohlendioxidsteuer auf alle Güter, importierte wie selbst erzeugte. Und verändert damit auch den Rest der Welt.
Wenn Ressourcenschonung Punkt eins der politischen Agenda würde, könnte China nicht nur die eigenen Unternehmen zu einer nachhaltigeren Produktion zwingen, sondern auch die reichen Länder dazu erziehen. Sie wären daran gehindert, ihre schmutzige Produktion auszulagern. Willkommen wären nur noch Unternehmen, die mehr Wert aus Gütern ziehen, weil sie länger halten und weniger Material verbrauchen. Die asiatischen Länder könnten auch wieder Nein sagen, wenn internationale Großkonzerne versuchen, der Bevölkerung unnötige Konsumartikel aufzudrängen. Oder wenn Chemie- und Agrarkonzerne die Landwirtschaft weiter industrialisieren wollen.
Was stört Sie daran?
Indiens ländliche Gesellschaft zu industrialisieren ist lächerlich. In Asien leben noch zwei Milliarden Menschen auf dem Land. Was sollen sie denn alle in den Städten tun? Noch mehr billige Exportartikel produzieren? In Indonesien, auf Java gibt es viele Traditionen der Gemeinschaft, des Teilens, Haushaltsgärten, Kreislaufwirtschaft. Ein großer Teil der Menschheit lebt bis heute nicht in einer formellen Ökonomie. Aber er spielt bei IWF und Weltbank kaum eine Rolle. Auch hier könnten Steuern auf CO2 und Rohstoffe eine andere Entwicklung fördern: Handarbeit würde wertvoller, das Leben als Kleinbauer aufgewertet.
In Asien gibt es ja Vorbilder, die für andere Werte stehen. Buddha hat vor Gier gewarnt, Konfuzius hat Bescheidenheit und Harmonie gepredigt, Gandhi stand für Konsumverzicht.
Sie spielen in der asiatischen Öffentlichkeit keine Rolle mehr. Es wäre wichtig, dass die nächsten Generationen solche Traditionen wiederentdecken. Auch dafür ist das Programm der 100 000 Akademiker gedacht. Geht zurück! Schaut euch Ideen an, die auf jahrtausendealtem Wissen basieren. Bisher studieren unsere Leute in Texas oder Ohio – das hat keinerlei Relevanz.
Bleibt die ganz große Frage: Wie lassen sich Konsum-Sehnsüchte zurückdrängen und fundamentale Veränderungen à la Nair durchsetzen?
Mit strengen Regeln und starken Staaten. Regeln sind nicht schlecht, Regeln sind notwendig. Als man in Deutschland angefangen hat, Sicherheitsgurte vorzuschreiben, haben die Leute das nicht gemocht. Heute ist das kein Thema mehr. Heute sagt der Bürgermeister von New York: Die Leute essen zu viel Junkfood und trinken zu viel Kaffee. Selbst die USA fangen also an zu intervenieren und Leute von Dummheit abzuhalten.
Globale Unternehmen werden aufschreien, ihre Lobbyisten in Marsch setzen oder sich andere Standorte suchen.
Wenn man überzeugt ist, dass Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch Herausforderungen sind, darf man nicht die Automobil- oder die Bergbau- oder die Erdölindustrie bitten, sich nett zu verhalten. Man kann Pizza Hut nicht bitten, weniger Pizzas zu verkaufen. Konzerne mögen keine Regeln, wenn diese Kosten erhöhen. Also bekämpfen sie Regeln ständig. Und wenn der Staat schwach ist, haben sie leichtes Spiel. Ist der Staat stark, sagt er: Kämpfen nützt nichts. Wir wissen besser, was richtig ist.
Aus Ihrer Sicht dürfte China der ideale starke Staat sein.
Die Zukunft hängt von zwei Ländern ab, Indien und China. In Indien ist die Möglichkeit, Veränderungen durchzusetzen, schwierig. Warum? Weil es eine Demokratie ist. Das chinesische Einparteiensystem mit seiner semikapitalistischen Ökonomie kann Macht ausüben und im Interesse des Gemeinwohls intervenieren. Das heißt nicht, dass das chinesische System nicht viele Schwachstellen hat. Aber für mich ist China demokratischer als Indien. Weil es besseren Zugang zu den Lebensrechten gewährt, bessere Lebensbedingungen.
Und dafür sollten wir hinnehmen, dass in China freie Meinungsäußerung unterdrückt wird? Immerhin gehört die zur UN-Charta, die auch von China ratifiziert ist.
Das ist eine schwierige Diskussion. Weil jeder gleich sagt: Oh, du bist gegen Freiheit. Aber das stimmt nicht. Es gibt eine Menge Asiaten, die das chinesische Dilemma verstehen. Es ist wie das Spiel mit einer Streichholzschachtel in einem Wald voller Zunder. Man sollte kein Feuer legen. Menschen in Entwicklungsländern haben keinen Schutz vor den Attacken der Modernität. Das westliche Urteil über das Internet heißt: Es ist gut, weil es Informationen verbreitet. Aber macht ihr euch im Westen klar, dass damit zum Beispiel die Erniedrigung von Frauen durch Gewalt nur einen Klick weit weg ist? Mit Zugang für jeden? Wer, bitte, schützt die Neunjährige in einer ländlichen Provinz in China, Kerala oder Kalimantan vor Pornografie? Nur der Staat kann es. Das westliche Argument der individuellen Freiheitsrechte klingt kultiviert und liberal - und ist unehrlich. So unehrlich wie das Argument in den USA gegen Schusswaffenkontrolle.
Bei Schusswaffen geht es um Leben und Tod. Das ist ein kleiner Unterschied zur freien Meinungsäußerung, oder?
In Indien korreliert der Internetzugang zur Pornografie mit der Gewalt gegen Frauen. Auch das hängt mit der Abwanderung vom Land zusammen, über die ich gesprochen habe. Die jungen Männer kommen in die Städte, finden keine Arbeit, was machen sie als Singles? Sie gucken Pornos. Weil es die im Internet umsonst gibt. Was passiert mit diesen Jungen, die Pornos gucken? Sie stammen aus alten Traditionen mit sehr viel Respekt vor Frauen. Und dann sind sie mit sexueller Gewalt konfrontiert, kostenlos. Vor zehn oder 15 Jahren hätte in Malaysia oder Indonesien kein junges Mädchen gewagt, ein Bild von sich im Bikini herumzuzeigen. Jetzt macht es das bei Facebook. Ich bin kein Moralist, ich sage nur: Denkt an die Folgen. Aber darüber spricht man nicht. Das soll ja Freiheit sein, und natürlich darf die westliche Idee der Moderne nicht angefochten werden. Wer es tut, gilt als rückwärtsgewandt. Aber auch hier gilt: Entwicklungen dürfen beschränkt werden; wenn sie antisozial sind, wenn sie unsere Zukunft gefährden oder unsere Kinder. Manchmal muss es heißen: "So nicht!"