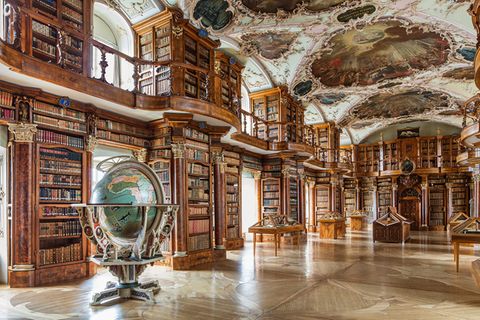"Und das hält?", fragt sich wohl jeder, der vor dem imposanten Neubau der Alnatura-Zentrale in Darmstadt steht. Die beiden 94 Meter langen Längsseiten des dreigeschossigen Baus bestehen aus jeweils zwölf Meter hohen, 4,5 Meter breiten und 70 Zentimeter dicken Riegeln, die an geologische Schnitte durch eiszeitliche Sedimente erinnern. Sie bestehen fast komplett aus Lehm und Kies. Sonst nichts. Keine Stahlarmierung, kein Zement. Mit dem Stahlbeton-Gerippe des Baus sind sie nur verbunden, damit sie bei Sturm nicht umkippen. Wird nicht der erste heftige Schlagregen im Herbst die Fassade aushöhlen, die Feuchtigkeit so weit eindringen, dass sich die naturnahe Ästhetik in brodelnden Schlamm verwandelt?
Martin Rauch kennt das ungläubige Staunen. Der Lehmbauer mit dem weißen Lockenkopf streicht mit seiner staubigen Pranke über die frisch errichtete Fassade und sagt: "Bauen mit Lehm macht Angst." Ein Schleier von hellem Lehmstaub zieht über die Oberfläche, einige größere Kieskörner lösen sich. Aber dies ist nicht sein erster Bau. Und wer ihm zuhört, versteht, warum Alnatura-Chef Götz Rehn sich für ihn entschieden hat. Und warum Lehm vielleicht der Baustoff der Zukunft ist. Oder sein sollte.

Bauen mit Lehm ist eine alte Technik
Dass Lehm hält, beweist schon ein Blick in die Architekturgeschichte. "Lehmbau ist eine uralte und bewährte Technik", sagt Rauch. Und noch heute wohne mehr als ein Drittel der Menschheit in Lehmhäusern. In Vergessenheit geriet das traditionelle Bauen erst im Zuge der Industrialisierung, als Energie, Zement und Ziegel für alle erschwinglich wurden. Nur in Krisenzeiten, sagt Rauch, etwa nach den beiden Weltkriegen, wurde es wieder interessant, weil Energie und Ressourcen knapp waren. 1946 trat sogar eine DIN-Norm in Kraft, die in Deutschland das Bauen mit Lehm regulierte. Doch Anfang der 1970er Jahre baute niemand mehr mit Lehm, die Norm wurde ersatzlos gestrichen.
Völlig zu Unrecht. Denn es gibt kaum eine nachhaltigere Art zu bauen. Während die Herstellung einer Tonne Zement rund 900 Kilogramm Klimagase freisetzt (und allein in Deutschland werden jedes Jahr 25 Millionen Tonnen verbaut), ist Lehm unschlagbar ressourcen- und energieschonend. Und ungiftig. Das macht auch die Entsorgung denkbar unkompliziert: Man könnte Lehmwände einfach umwerfen und liegen lassen. In Darmstadt zum Beispiel als Lebensraum für die seltenen Zauneidechsen, die vor der Grundsteinlegung umgesiedelt werden mussten. Ebenso gut aber ließe sich der Rohstoff einfach ein zweites Mal verwenden.

Aus der Stuttgart 21-Baugrube nach Darmstadt
Für die Alnatura-Zentrale in Darmstadt entschied sich Rauch für einen Rohstoff mit einer besonderen Geschichte: Rund 80 Prozent des Lehms, der in Darmstadt verbaut wurde, stammt aus der Baugrube für Stuttgart 21. Rauch, der seit 27 Jahren mit Lehm baut, hatte zufällig im Vorbeifahren gesehen, welches Potenzial in der aufgerissenen Erde der Baden-Württembergischen Hauptstadt schlummert. "Daraus hätte man ganze Städte bauen können", meint der Vorarlberger.
Die komplette Fassade besteht aus 350 Lehmelementen, die Rauch und seine Mitarbeiter in einer benachbarten Panzerhalle auf dem ehemaligen Kasernengelände vorfertigten. Jedes einzelne von ihnen ist ein Sandwich aus 38 Zentimeter gestampftem Lehm, 17 Zentimeter Dämmschicht aus Schaumglas und noch einmal 14 Zentimeter Lehm – inklusive der Heizschlangen einer Geothermie-Wandheizung. Lediglich die Innenwände werden noch mit einem natürlichen Bindemittel imprägniert.

Wie Lehm der Witterung widersteht
Warum das ausgerechnet an den Außenwänden, die Wind und Regen ausgesetzt sind, nicht erforderlich ist, erklärt Rauch so: Zwar wird der Regen zunächst die äußersten Schichten feinster Lehmpartikel abwaschen. Doch mit der Zeit konserviert sich die Fassade selbst – durch austretende Salze, die an der Oberfläche mineralisieren und so den darunterliegenden Lehm imprägnieren. Martin Rauch nennt das "kalkulierte Erosion". "Ich habe schon zwei-, dreihundert Jahre alte Wände gesehen, die voll dem Wetter ausgesetzt sind", erzählt der gelernte Bildhauer und Keramiker. Zusätzlich verhindern im Abstand von 60 Zentimetern eingebaute Riegel aus festerem Trasskalk, dass sich durch Regenwasser senkrechte Erosionskanäle in die Wände graben.
Ein weiterer Vorteil des natürlichen Baustoffs: Beton wird mit der Zeit grau. Lehm dagegen behält durch die Jahrhunderte immer dieselbe leuchtende Farbe. Er nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf und gibt sie ab, wo sie fehlt. Solche diffusionsoffenen Baumaterialien sorgen – ganz ohne Klimaanlage – für ein perfektes Raumklima.
Auf das sind Alnatura-Gründer und Bauherr Götz Rehn und 500 seiner Mitarbeiter, die in der zweiten Jahreshälfte 2018 aus dem nahegelegenen Bickenbach in das "nachhaltigste Bürogebäude Deutschlands" (Rehn) umziehen werden, schon sehr gespannt. Auf die Pionierleistung von Martin Rauch angesprochen, meint Rehn lachend: "Ich mache laufend Sachen, von denen ich nicht weiß, ob sie funktionieren." Doch dem Lehmbauer, so viel ist klar, vertraut er blind.
Die Website des Lehmbauers Martin Rauch: www.lehmtonerde.at