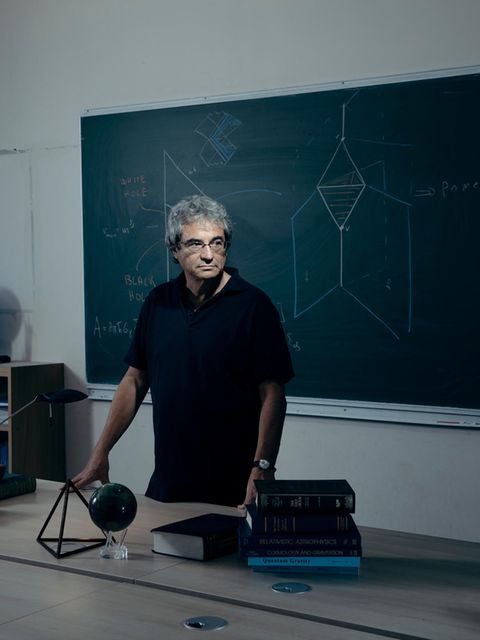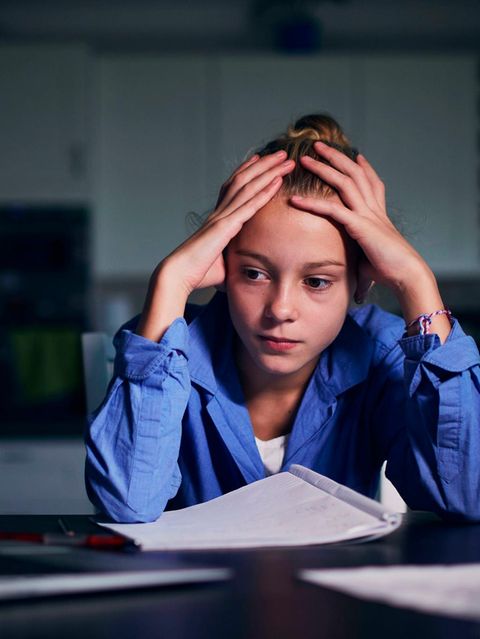Soziale Phobie
Als ich Martin Junge* zum ersten Mal in der Klinik traf, verdeckten seine Haare das Gesicht, er saß gebeugt da und mied meinen Blick. Zweimal hatte er ein Studium abgebrochen. Es war für den 24-Jährigen unerträglich, unter den Augen der anderen in der Mensa zu essen; auch einen Hörsaal konnte er nicht betreten, ohne zu zittern. Zu groß war die Angst, rot zu werden, zu versagen, sich vor anderen zu blamieren, ausgelacht und verhöhnt zu werden. Er zeigte die typischen Merkmale einer Sozialen Phobie. Er versuchte, die Angst mit Drogen zu mindern, rauchte Cannabis, nahm Kokain und Beruhigungsmittel. Manchmal schlug er sich die Hände an den Wänden blutig, aus Wut über seine „Scheiß-Angst“. Das verschaffte ihm ein Gefühl der Erleichterung, und er konnte sich wieder „männlich und stark“ fühlen. Denn Martin Junge hat zusätzlich eine Persönlichkeitsstörung entwickelt, die ihn lieber Schmerzen ertragen lässt als Panikgefühle. So werden die Betroffenen aus dem Sog der Angst herausgerissen – und können die Realität wieder wahrnehmen. In der Verhaltenstherapie sollte Junge zunächst lernen, wie er mit der Beklemmung umgehen kann, ohne sich selber zu verletzen. So altmodisch es klingen mag: Es zeigte sich, dass es ihm hilft, an einem Fläschchen mit Minzöl zu riechen; denn der Geruch ist sehr scharf und intensiv. Wie ein Schmerz fordert er die volle Aufmerksamkeit – und lenkt so von der angstbedingten Anspannung ab, hilft dabei, zurück in die Realität zu kommen. Im zweiten Schritt sollte er Situationen erleben, die zeigen, dass seine Befürchtungen keinen Grund haben; dass niemand ihm etwa Vorwürfe macht oder lacht, wenn er etwas sagt, wenn er sich zeigt, wie er ist. Dabei helfen vor allem Verhaltensexperimente in einer Gruppe. So sollte Junge beispielsweise einen kurzen Text lesen und den anderen Patienten darüber berichten. Anfangs machte ihn das extrem nervös, er fürchtete, zu leise zu sprechen, zu stottern, zu schwitzen. Doch mit der Zeit wurde er selbstsicherer. Er erlebte, dass die Angst zwar da sein mag – dass aber selten alle Befürchtungen eintreffen. Zehn Wochen verbrachte Junge in der Klinik. Und gewann an innerer Stärke. Heute blickt er anderen direkt in die Augen und kann fast unbeschwert ein wenig plaudern.
Kathin Dreysse

Hypochondrie
Christian Braun* wurde von der Angst beherrscht, einer tödlichen Erkrankung zu erliegen. Bevor er zu uns kam, las der 42-Jährige stundenlang im Internet Beschreibungen von körperlichen Leiden, immer wieder untersuchte er sich selbst vor dem Spiegel oder verlangte Termine bei Ärzten. Aus Angst, sich womöglich zu infizieren oder zu verletzen, mied er Menschen; er vereinsamte – und zur Krankheitsangst, der Hypochondrie, kamen bald auch noch depressive Gefühle. Der Ursprung seiner Phobie liegt vermutlich in seiner Kindheit. Er wuchs behütet auf, wurde sehr geliebt von seinen Eltern. Aber er lernte von ihnen auch, dass die Welt viele Gefahren birgt. Immerzu sollte er aufpassen, sich festhalten oder langsamer bewegen. Als er 18 Jahre alt war, starb ein enger Freund an Leukämie. Damals, so sieht es Braun heute, begannen seine Befürchtungen, selbst schwer zu erkranken. In der Klinik versuchte ich, diese Ängste in ihm immer wieder zu wecken. Ich ließ ihn medizinische Lehrbücher lesen, zeigte ihm Berichte von Operationen, führte ihn dorthin, wo einem die eigene Sterblichkeit besonders bewusst wird: auf einen Friedhof. Jedes Mal, wenn Panik oder Trauer ihn packten, fragte ich ihn, was genau er erlebt, fühlt, denkt. Denn oft lässt sich erst dann, inmitten der Emotion, aussprechen, woher sie rührt. Wie bei vielen Hypochondern war bei Braun die Angst mit tiefen Sehnsüchten verwoben. Er ist davon überzeugt, dass er nicht erreichen wird, was er sich wünscht: eine liebende Partnerin zu finden, eine stabile Beziehung aufzubauen, ein Zuhause, eine Familie. Diese Furcht bewirkte, dass er sich über die Jahre immer stärker auf das fokussierte, was ihm womöglich gefährlich werden könnte. Der Klinikaufenthalt kann nur der erste Schritt sein. In einer ambulanten Therapie wird Christian Braun sich weiter mit seinen Hoffnungen auseinandersetzen müssen – und erkunden, wie er sie realisieren oder sich von ihnen verabschieden kann. Denn erst dann, so denke ich, wird er sich ganz von der übermäßigen Angst lösen.
Mykola Fink

Körperdysmorphe Störung
Wer Justus Mayer, 28*, begegnet, kann nicht ahnen, dass er mit schweren Ängsten zu kämpfen hat. Mayer ist jung, smart, eloquent, hervorragend ausgebildet, arbeitet in einem internationalen Finanzunternehmen, ist äußerst erfolgreich und sieht überdurchschnittlich gut aus. Doch genau das erlebt er anders: Er leidet an einer Körperdysmorphen Störung und kann es kaum ertragen, sich im Spiegel zu betrachten; er wird bei dem Anblick nervös, unsicher, unwillkürlich steigert sich seine Aufregung. Ehe er in die Klinik kam, beschäftigte er sich oft über Stunden mit seinem Aussehen, inspizierte sein Gesicht, wusch sich wieder und wieder die Haare. Stets hatte er Sorge, andere könnten ihn für hässlich halten; intime Beziehungen waren ihm unmöglich. Vor allem seine Ohren und seine Zähne hielt er für unansehnlich und hat sie daher mehrfach operieren lassen. Vermutlich hat sich das Leiden in der Pubertät herausgebildet. In dieser Lebensphase achten ja sehr viele Menschen übertrieben sensibel auf Veränderungen des eigenen Körpers und vergleichen sich mit anderen. Doch bei Mayer ging das nicht vorbei. Vielmehr verinnerlichte er in jener Zeit, wie wichtig Leistung und Perfektion sind. Und übertrug dieses Grundgefühl in überzogenem Maß auch auf sein Äußeres. In der Verhaltenstherapie sollte der Patient in Übungen erleben, dass sein Aussehen weit weniger Aufsehen erregt als ver- mutet. So musste Mayer immer wieder Tage ungewaschen und unfrisiert verbringen, um zu sehen, was tatsächlich passiert. Oder lernen, wieder Fotos von sich zu betrachten und sich darauf wertfrei zu beschreiben. Außerdem habe ich mich mit ihm behutsam seinem größten Feind genähert: dem Spiegel. Er musste mir beschreiben, was er sieht und fühlt. Scheu und Scham wallten dann in ihm auf. Doch das ist der Weg dieser Heilmethode: Man muss sich den Gefühlen aussetzen, muss mitten durch sie hindurch und wieder seinen gesamten Körper wahrnehmen. Als Therapeut kann ich ihn unterstützen, den Mut dafür zu finden.
Christian Stierle

Panikstörung
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter fiel Maria Schmidt* in tiefe Trauer. Aus Angst vor diesem Gefühl mochte sie kaum noch allein sein. Sobald die 22-Jährige einmal für sich war, drohte sie die Sehnsucht nach der Verstorbenen wieder zu überwältigen – und sie geriet deshalb in Anspannung, die sich immer weiter steigerte: Ihr Puls beschleunigte sich, sie spürte Schwindel und quälende Angst. Muss auch ich sterben, fragte sie sich. So wurde aus einer Trauer eine Panikstörung. Aus Angst vor diesen Attacken vermied sie es, allein zu sein. Aber auch die Öffentlichkeit ertrug sie nicht; sie musste stets Freunde oder Familie um sich haben. Ein Arzt verschrieb ihr Beruhigungsmittel. Doch die Folge war, dass sie nur noch mithilfe des Medikaments ein wenig Ruhe finden konnte. Sie kämpfte 18 Monate lang, ehe sie zu uns nach Bad Bramstedt kam. In der Therapie ging es vor allem um eines: Sie musste lernen, dass die panischen Empfindungen nicht gefährlich für sie sind – und sie immer stärker werden, je mehr sie sie fürchtet. Ich suchte daher Wege, solche Regungen in ihr zu provozieren. Sie musste in einem Treppenhaus auf und ab rennen, damit sie das verabscheute Herzrasen spürt; im Wald musste sie sich immer wieder um die eigene Achse drehen, bis ihr schwindlig wurde – und dann mit raschen Schritten geradeaus gehen. So merkte die Patientin, dass sich die körperlichen Anzeichen von Aktivität und die Regungen der Panik sehr ähneln. Vereinfacht gesagt: So wie sich ein Körper bei einem Training allmählich an einen bestimmten Bewegungsablauf gewöhnt, so muss sich das Gehirn in der Therapie daran gewöhnen, dass es keine Angst auszulösen braucht, wenn etwa Puls oder Atmung etwas schneller werden. Am Ende der Therapie sollte Maria in eine fremde Stadt fahren, allein. Ich gab ihr Umschläge mit, die sie nach und nach öffnen sollte. Jeder enthielt eine Anweisung, etwa: Steige auf den Kirchturm. Beim Aufstieg erlebte sie zwar, wie der Puls zu rasen begann – aber empfand es nicht mehr als beängstigend.
Christina Sagebiel
* Die Namen aller Betroffenen wurden von der Redaktion geändert. Die Abgebildeten waren oder sind Patienten der Schön Klinik Bad Bramstedt, alle Therapeuten arbeiten dort. Alle vier Protokolle stammen aus GEO WISSEN "Ängste überwinden, innere Stärke gewinnen".