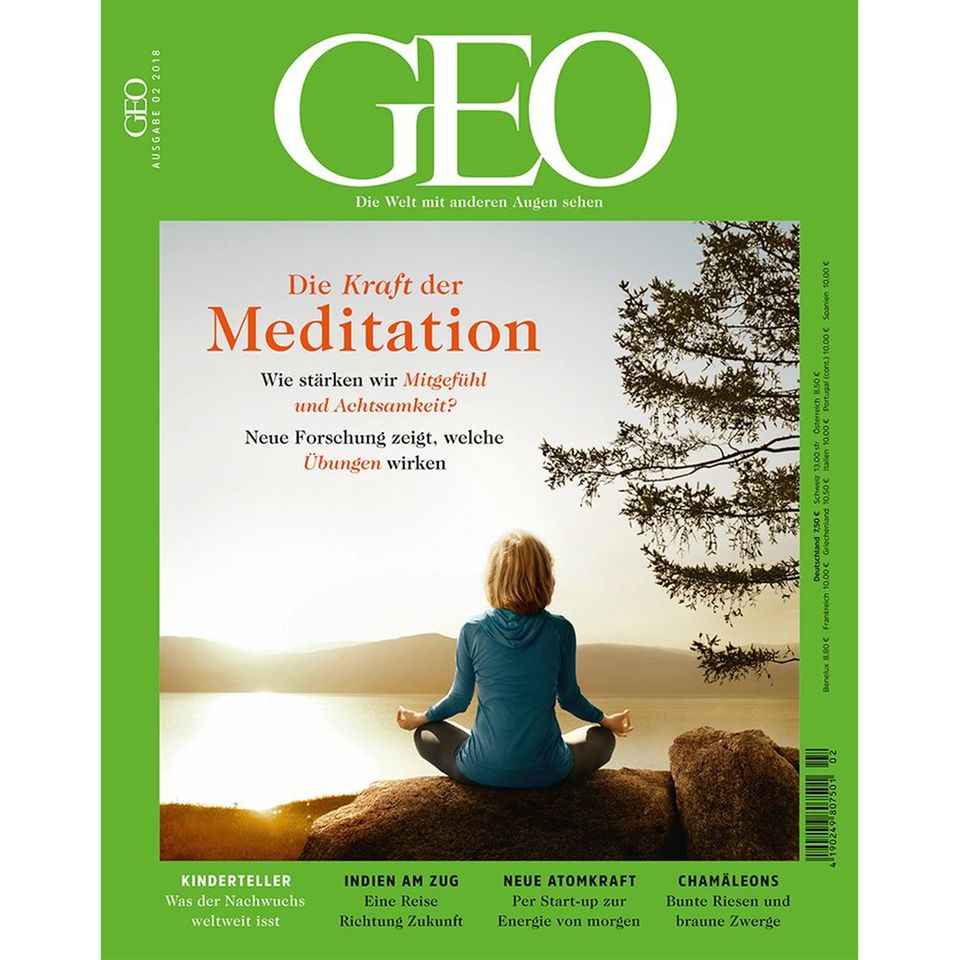Was bekommen die Kinder auf den Teller und was sagt das über die Esskultur ihres Landes aus? Professor Marin Trenk forscht an der Universität Frankfurt, Schwerpunkt kulinarische Ethnologie, und kommentiert, was auf dem Speiseplan der Kinder steht. Die Bilder zeigen jeweils das Essen einer Woche.
Andrea aus Catania, Italien
Professor Marin Trenk: Pizza mit Pommes frites? Es bleibt der einzige kulinarische Ausreißer des Jungen. Die italienische Küche ist fest in sich verwurzelt, klassisches „Kinderessen“ kennt man dort kaum, Andrea bekommt das Gleiche wie Erwachsene auf den Teller. Das sieht man nicht nur an der Seebrasse, die sogar mit Kopf serviert wird, sondern auch an der Pasta mit Linsen oder Speck: Mit den Nudeln in Fertigsoße, die deutschen Kinder angeboten werden, hat sie nichts gemein.
Siti aus Kuala Lumpur, Malaysia
Professor Marin Trenk: Als der Mensch vor rund 12 000 Jahren anfing, Ackerbau zu betreiben, hat sich in jedem Land eine Pflanze als Basis der Esskultur etabliert. Ethnologen nennen sie „Superfood“, oft ist es ein Kohlenhydrat: In Europa ist es der Weizen, in Afrika die Jamswurzel, in Südamerika die Kartoffel. In Südostasien, wie in Malaysia, nimmt der Reis die Rolle des Superfood ein, Siti isst ihn jeden Tag. Zum Beispiel zum Frühstück in Form des traditionellen „Nasi Lemak“: Reis in Kokosmilch mit Sambal, einer Würzpaste (hier auf Papier). Zu Hause kombiniert sie ihn mit Hühnchen oder Wels, einem preisgünstigen Fisch, den man gut züchten kann. Die Konsequenz, mit der die Eltern dem Mädchen täglich Reis vorsetzen, unterscheidet sie von Europäern, die längst nicht mehr an ihrem Superfood als Hauptbestandteil einer jeden Mahlzeit festhalten.
Frank aus Dakar, Senegal
Professor Marin Trenk: Die Chipstüten stehen für ein weltweites Phänomen: Obwohl Senegal ebenso wie etwa Malaysia, Italien oder Indien an den Wurzeln seiner Esskultur festhält, ist auch hier das Phänomen der „globalisierten Snackkultur“ angekommen: Der Junge isst nicht nur Frühstück, Mittag- und Abendessen, sondern jeden Tag mindestens einen Snack. Diese Zwischenmahlzeiten haben mit dem ursprünglichen Essen des Landes oft nichts mehr zu tun. So stehen auch Pizza, Eis und Fertigkuchen auf dem Speiseplan des Jungen. Viele dieser Produkte kommen von westlichen Herstellern.
June, John und Greta aus Hamburg, Deutschland
Professor Marin Trenk: Sucht man auf den Tellern der deutschen Kinder nach typisch nationalen Gerichten, findet man: nichts. Deutschland ist erst spät – mit Gründung des Deutschen Reichs im Jahr 1871 – eine Nation geworden. Folglich war unsere Küche im Gegensatz zu der im benachbarten Frankreich jahrhundertelang ausschließlich regional geprägt. Später verhinderten die Hungerjahre durch zwei Weltkriege die Ausbildung einer gesamtdeutschen Küche. Heute pflegen die Norddeutschen ihre regionale Esskultur nicht in dem Maße wie ihre Landsleute im Süden. Die Hamburger Kinder haben Bayerisches und Schwäbisches auf dem Teller: Brezel und Käsespätzle. Auch sieht man eine Vorstellung, die neben Deutschland wenige Länder (etwa Großbritannien) pflegen: kleiner Mensch, simples Essen. Ernähren sich Kinder in Indien oder Italien meist wie die Großen, bekommen sie in Deutschland vereinfachte Formen von „Erwachsenenessen“ auf den Tisch: Nudeln mit Tomatensoße, Pommes frites, Würstchen, Salamibrötchen. Und die Fischstäbchen, das beliebteste „Meerestier“. Einziger Ausreißer ist der Tintenfisch auf Junes Speiseplan.

Adveeta aus Mumbai, Indien
Professor Marin Trenk: Seit jeher teilen die Brahmanen, Angehörige der höchsten Kaste in Indien, das Ideal der Gewaltlosigkeit: Sie verzichten komplett auf Fleisch. Nach ihrem Vorbild lebt die Familie von Adveeta. Zudem ernährt sie sich fast nur von typisch Indischem: ungesäuertem Fladenbrot (Roti), Linsen, Reis, Chutney und Curry. Eine Ausnahme ist die Marmelade zum Frühstück – ein Relikt der britischen Kolonisation. Skurril: Wie viele Inder hat Adveeta eine unerklärliche Leidenschaft für Tomatensuppe.
Hank aus Alta Dena, USA
Professor Marin Trenk: Schwere Mahlzeiten isst Hank nur am Abend: Spaghetti in Tomatensoße, Schweineschulter mit Barbecuesoße an Grünkohl oder Steak. Zu Mittag sollen Sellerie, Brokkoli, Hummus und ein Glas Kombucha bei diesem kalifornischen Jungen für eine gesunde Ernährung sorgen. Dabei kommen seine Eltern teils auf kuriose Ideen: Als Snack zwischendurch trinkt der Junge die Flüssigkeit aus dem Peperonciniglas.
Soulaymane aus Nizza und Rosalie aus Èze, Frankreich
Professor Marin Trenk: Wie kaum eine andere Stadt Frankreichs hat Nizza eine eigene Esskultur entwickelt, die auch vom Nachbarn Italien mitgeprägt wird. Um die traditionellen Rezepte zu bewahren, wurde das Label „Cuisine Nissarde“ eingeführt. Mehrmals die Woche essen Rosalie und Landim frischen Fisch wie etwa Sardellen, die an der Küste gefangen werden. Das Mädchen nascht außerdem „Cailletiers“, die als Nizza-Oliven bekannt sind und bis an die italienische Grenze angebaut werden. Trotz viel französischer Küche stehen auch die Kinderklassiker auf dem Speiseplan der Kinder: Bratwürstchen mit Kartoffelpüree und Pizza.
Majo aus Wedel, Deutschland. Ehemals aus Syrien
Professor Marin Trenk: Majo kam vor gut zwei Jahren aus Syrien nach Deutschland. Bis heute isst er weitgehend wie von zu Hause gewohnt: Auf dem Speiseplan stehen Kebab, gefüllte Weinblätter, Reis mit Köfte (Hackfleischbällchen), Suppe mit Auberginen und Paprika. Wird er in den nächsten Jahren beginnen, auch deutsche Spezialitäten zu verzehren? Wohl kaum. Eher werden die Norddeutschen Elemente aus der Küche der syrischen Flüchtlinge übernehmen. Eine mögliche Erklärung: Wer etwa selbst kaum eine innere Verbundenheit mit der eigenen Küche verspürt, kann schwer andere dafür begeistern. Anders wäre es vielleicht, wenn der Junge ins südliche Deutschland, nach Bayern gekommen wäre: Dort hat man es sogar geschafft, die Regionalküche international als „German Cuisine“ zu vermarkten.
Sira aus Tambacounda, Senegal
Professor Marin Trenk: Was in Indien die Linsen sind, ist im Senegal die Erdnuss. Sie wird den meisten Gerichten, meist in gemahlener Form, beigemischt. Sie ist auch Hauptbestandteil der Soßen, in denen das Fleisch des Mädchens Sira schwimmt. Der Gedanke dahinter folgt einer simplen Überlegung: Oft müssen Familien mit wenig Geld viele Kinder satt bekommen, dabei hilft die Hülsenfrucht. Für sie werden große Anbauflächen im Land verwendet.