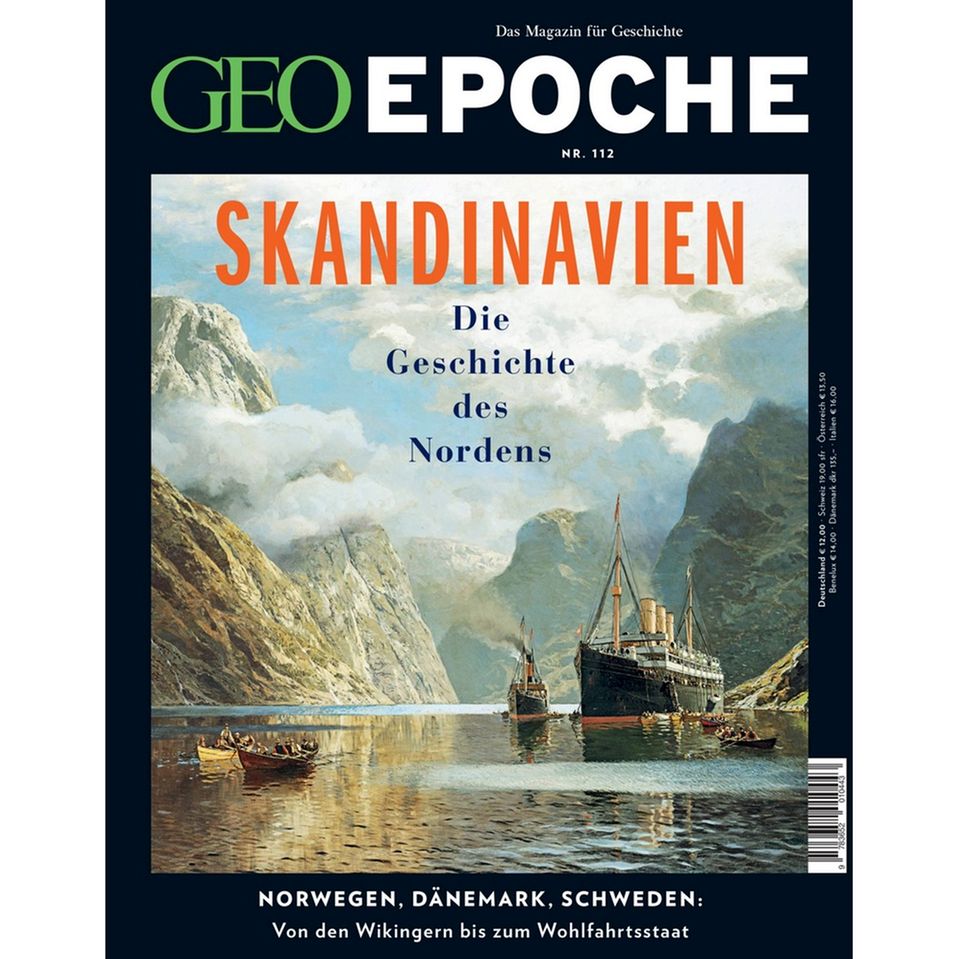Bei Thors Hammer, was ist das für ein Mann? Ein wilder Hund in der Schlacht, wie es in Legenden heißt? Ein durchtriebener Stratege auf dem Thron, ein auf Beutezügen reich gewordener Machtmensch, der sich zwar als erster Wikingerkönig zum Christentum bekennt, doch nur, um seine Herrschaft zu sichern? Der nach Vergrößerung seines Reiches giert, dabei aber doch weitsichtig genug ist, sein sumpfiges Land mit dem Bau von Straßen zu festigen, mit Brücken, Verteidigungsanlagen – und dazu einen Stein mit der vielleicht berühmtesten Inschrift der dänischen Geschichte hinterlässt?
Knapp zehn Tonnen wiegt das geradezu unumstößliche Zeugnis seines Lebens und seiner Taten, aufgestellt am einstigen Königshof seiner Dynastie im dänischen Jütland. Ein paar Runen in rotem und schwarzem Granit nur, die von einem der wichtigsten Ereignisse in der nordischen Geschichte berichten: "König Harald ließ dieses Denkmal zur Erinnerung an König Gorm, seinen Vater, und seine Mutter Thyra errichten; jener Harald, der ganz Dänemark und Norwegen gewann und die Dänen zu Christen machte."
Wer war Harald Blauzahn?
Andere Schriftzeugnisse existieren nicht von diesem Harald Gormsson. Erst um 1200 gibt eine dänische Chronik weitere Details preis. Und lange nach seinem Tod wird der Herrscher auch in der Welt der nordischen Sagen lebendig. Entsteht schließlich ein vages Bild seines Lebens und Wirkens, das viele Jahrhunderte später noch durch archäologische Erkenntnisse ergänzt wird.
Das Bild eines Mannes, der der Nachwelt womöglich wegen eines abgestorbenen Zahns als "Harald Blauzahn" in Erinnerung bleibt – und unter dessen Herrschaft sich der vielleicht tiefgreifendste Wandel in der Geschichte der Dänen vollzieht: Der Wikingerkönig Harald Blauzahn eint ihre Heimat erstmals politisch, führt Dänemark sogleich an die Spitze Skandinaviens – und ebnet ihm den Weg in die abendländische Staatenwelt.
DÄNEMARK AM ENDE DES 1. JAHRTAUSENDS, ein Land aus Inseln und Wäldern, Seen und Marschen, fruchtbaren Äckern und sandigen Böden. Eine heidnische Welt, in der die Menschen an Elfen und Riesen glauben und Odin verehren, den einäugigen Gott der Magie und des Krieges, der ein Auge für einen Schluck aus der Quelle der Weisheit gab. Das Christentum verachten sie, sofern sie ihm begeg-net sind. Einen "blutrünstigen Drachen" nennt der Kleriker Adam von Bremen Harald Blauzahns Großvater, den Dänenherrscher Harthacanute Gorm, der angeblich Geistliche verfolgen und nicht selten zu Tode foltern lässt.
Bereits seit dem frühen 8. Jahrhundert gibt es Versuche, das Evangelium nach Skandinavien zu bringen. Als einer der Ersten reist der Angelsachse Willibrord nach Dänemark, um einen als grausam geltenden Herrscher zu bekehren. Der Missionar scheitert, kehrt aber mit 30 Jungen im Gefolge zurück, die er im christlichen Glauben unterrichten darf.
829 macht sich der Benediktinermönch Ansgar im Auftrag des fränkischen Kaisers Ludwig des Frommen auf den Weg zum schwedischen Birka, einem bedeutenden Fernhandelsplatz auf einer Insel im See Mälaren (unweit des heutigen Stockholm). Der dortige König hat selbst um einen Geistlichen gebeten. Zwar ist der Regent kein Christ, doch gibt es christliche Händler in der Stadt; ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Möglichkeit, an einem Gottesdienst teilzunehmen, soll weitere Kaufleute anlocken.
Unterwegs wird Ansgars Schiff von Wikingern überfallen, die Geschenke, die er dem Schweden als Dank für seine Einladung überreichen wollte, werden geraubt. Doch der Mönch setzt seine Reise fort – und sorgt dafür, dass in Birka eine erste Kapelle errichtet wird. Nach seiner Rückkehr erhält Ansgar vom Papst den Auftrag, Dänen und Schweden für den christlichen Glauben zu gewinnen.
Auch andere lokale Fürsten erkennen bald die Vorteile, die eine Duldung des Christentums für sie hat. Um 850 erlaubt der dänische Machthaber Horik I. den Bau einer Kirche in Haithabu, der ersten in Dänemark. Die am Südufer der Schlei gelegene Siedlung ist der größte Handelsplatz Skandinaviens – und ein Ort der Vielfalt: Heidnische Wikinger, christliche Fernhändler aus fast ganz Europa und sogar Muslime aus dem Orient bieten dort Waren an; feine Tuche, Schmuck, Tischgeschirr, Gläser – und Sklaven.
Sein Thronfolger gestattet einige Jahre später das Läuten der Kirchenglocken in Haithabu, zum Ärger der heidnischen Bevölkerung. Aber die Zugeständnisse sind wohlkalkuliert und stärken die Position des Regenten: So genießt er jetzt Anerkennung durch Papst und Kaiser. Da der Dänenherrscher sich aber nach wie vor zu den Göttern seiner Vorfahren bekennt, unterstützt ihn auch der eigene Adel.
Die Strategie des Wikingerkönigs zahlt sich aus: Der Handel blüht auf, etliche heidnische Kaufleute entscheiden sich für die prima signatio, einen christlichen Segen, der aber die Anbetung der alten Götter erlaubt. So können die Getauften mit Christen wie Nichtchristen gleichermaßen guten Umgang pflegen.

Doch obwohl eine weitere Kirche in dem Handelsort Ribe entsteht, verbreitet sich der Glaube nicht. Zumal die Bekehrungsversuche immer häufiger unter Zwang erfolgen: Kaiser und Könige aus den deutschen Landen drängen auf die Missionierung der Dänen, weniger aus religiösem Eifer, eher aus politischem Kalkül – bedeutet die Unterwerfung unter Christus doch nichts anderes als eine Unterwerfung unter den weltlichen Herrscher. So fordert König Heinrich I., nachdem er die Dänen 934 im Kampf besiegt hat, seine Gegner angeblich dazu auf, sich taufen zu lassen. Überzeugte, ihm untertänige Christen werden sie dadurch nicht.
Auch Harald Blauzahns Vater lehnt den neuen Glauben vermutlich ab. Nicht viel ist über Gorm den Alten bekannt, dem es aber offenbar gelingt, sich in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts an die Spitze eines oft in Bürgerkriegen versunkenen und von einer Vielzahl von Häuptlingen oder Königen regierten Reiches zu setzen.
Dänemark erstreckt sich seit etwa 800 bis in die heutigen südschwedischen Gebiete Halland und Schonen. Im Süden endet der Machtbereich, darauf hatten sich 811 nach Kämpfen zwischen Franken und Wikingern Kaiser Karl der Große und der Dänenkönig Hemming verständigt, am Fluss Eider. Zur Nordsee hin ist das Grenzgebiet versumpft und ohnehin unpassierbar, im östlichen Bereich schützt ein rund 30 Kilometer langes Bollwerk aus Gräben und mit Holzpalisaden versehenen Erdwällen die Grenze: das Danewerk, die größte Festungsanlage Skandinaviens. Sehr wahrscheinlich reicht die Macht nordischer Anführer aber schon Jahrhunderte zuvor bis hierher; davon künden von Archäologen entdeckte Vorgängerbauten des Danewerks.
Gorm stammt vermutlich aus dem südlichen Teil Dänemarks und heiratet aus politischen Gründen eine Prinzessin, die man später in Schriften für ihre Schönheit preist, ihren Geist, ihre Kraft: Thyra, den "Stolz Dänemarks", wie der König in Runen in einen Stein ritzen lässt; es ist das erste Mal, dass der Name "Dänemark" schriftlich auf dänischem Boden erwähnt wird. Zum Zentrum seines Reiches macht Gorm den Ort Jelling auf der reichen Halbinsel Jütland.
UM DAS JAHR 930 BRINGT KÖNIGIN THYRA ihren zweiten Sohn zur Welt, Harald. Als der ältere Bruder stirbt – den Lieblingssohn Gorms trifft bei einem Überfall in Irland ein Pfeil, so berichtet es der dänische Chronist Saxo Grammaticus –, folgt er diesem auf den Thron. 15 Jahre lang regiert er gemeinsam mit seinem Vater, bis der alte Herrscher im Winter 958/59 stirbt.
Harald Blauzahn lässt ein gigantisches Grabmal errichten
Handelt es sich tatsächlich um sein Skelett, das Wissenschaftler Jahrhunderte später in Jelling entdecken, ist Gorm noch an seinem Lebensende von robuster Statur. Ein 1,73 Meter großer und höchstens 50 Jahre alter Mann, den jedoch Arthritis im Rücken und Zahnschmerzen geplagt haben müssen.
Harald lässt für seinen Vater ein gigantisches Grabmal errichten: ein 350 Meter langes, aus mannshohen Steinen geformtes Schiff, das die Reise ins Totenreich symbolisiert. Der Leichnam wird in einer 18 Quadratmeter großen und knapp 1,50 Meter tiefen, mit Holz ausgekleideten und wuchtigen Eichenstämmen verschlossenen Grube im Zentrum beigesetzt. Rund drei Jahre lang häufen Arbeiter Steinmassen über die Kammer, überziehen das Monument mit einem Gerüst aus Ästen und bedecken es schließlich mit Heide und Grassoden. 64 Meter beträgt der Durchmesser des Hügels, ein acht Meter in der Landschaft aufragendes Denkmal.
An Dänemarks Spitze steht nun ein König, über dessen Wesen die historischen Quellen nur wenig berichten. Die Sagas immerhin stellen Harald Blauzahn als unerschrockenen, aber durchaus sorgsam abwägenden Mann dar, der angeblich Island erobern will – doch von seinem Plan ablässt, als ihm ein Kundschafter mit übernatürlichen Fähigkeiten von Monstern berichtet, die auf der Insel leben. Der aber auch ein gefühlloser Tyrann ist, wie der Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus notiert: Stellt angetrunken in großer Runde einen treuen Kriegsbruder namens Palna-Toki auf eine teuflische Probe und zwingt ihn, mit einem Pfeil einen Apfel vom Kopf seines ältesten Sohnes zu schießen.
Und der nach den Schilderungen eines Mönches letztlich so von Missgunst und Eifersucht zerfressen ist, dass er später sogar gegen den eigenen Sohn in den Krieg zieht.
Zweifellos ist Harald Blauzahn ein selbstbewusster Regent. Zu Beginn seiner Herrschaft treibt ihn vor allem der schwelende Konflikt mit den Nachbarn im Süden um: Die Soldaten des römisch-deutschen Herrschers Otto I. drängen in Richtung Danewerk, um die Dänen zur Anerkennung seiner Vorherrschaft und zum Christentum zu zwingen.
Wohl aus Einsicht, dass er Ottos Truppen nicht dauerhaft standhalten könnte, raubt der Regent ihm vermutlich um das Jahr 965 jeden Vorwand für einen Angriff – und trifft eine der folgenreichsten Entscheidungen in der Geschichte Skandinaviens: Harald Blauzahn, heidnischer König der Dänen, bekennt sich zum Kreuz Christi.
Der Wikinger lässt sich vermutlich in Haithabu oder in Aarhus taufen, einer weiteren, 70 Kilometer nordöstlich von Jelling gelegenen dänischen Handelsmetropole. Doch seltsam: Kein Dokument, keine Aufzeichnung beschreibt das Ereignis. Nur eine vergoldete Reliefplatte aus dem 12. Jahrhundert zeugt von dem Taufakt. Sie zeigt Harald in einem großen Bottich, neben ihm der deutsche Missionar Poppo, der den Heiden angeblich durch ein Wunder bekehrt hat: Auf einem Fest habe Harald den Priester auf die Probe gestellt und behauptet, dass andere Götter zu weitaus größeren Wundern und Zeichen fähig seien als Christus – so berichtet es der sächsische Mönch Widukind. Poppo habe daraufhin ein glühendes Eisen umfasst und dem überraschten König schließlich eine unversehrte Hand gezeigt.
Doch es bleibt fraglich, ob Harald den alten Göttern wirklich aus Überzeugung abschwört. Fest steht nur, dass er seinem Bekenntnis Taten folgen lässt. Christliche Symbole werden in den folgenden Jahren alltäglich. Weitere Kirchen entstehen, und in neue Silbermünzen ist nicht selten auf beiden Seiten ein Kreuz geprägt. Sogar seinen Vater, der als Heide gestorben war, lässt der König exhumieren und in einer Holzkirche direkt neben dem Grabhügel im Geist des neuen Glaubens wieder begraben.
Als geradezu vorbildlichen König preist der Geistliche Adam von Bremen das Dänenoberhaupt, und tatsächlich scheinen sich die Beziehungen zu den südlichen Nachbarn nach der Taufe zu bessern.
DASS OTTO I. PATENONKEL von Haralds Sohn Sven Gabelbart wird, den der skandinavische Herrscher angeblich mit einer Mätresse zeugt, mag Legende sein. Sicher aber erkennt der König den Dänen nun als christlichen Herrscher an und verzichtet auf seine kaiserlichen Rechte über die wenige Jahre zuvor vom Erzbischof des Bistums Hamburg-Bremen gegründeten drei dänischen Diözesen Haithabu, Ribe und Aarhus.
Der Wikingerherrscher lässt das Danewerk ausbauen
Und doch ist der Friede im Land brüchig; Harald scheint Otto I. nicht zu trauen. Auch versucht er nicht, wie unter Herrschern üblich, die Beziehung mit dem Nachbarreich durch eine Heirat zu festigen. Stattdessen nimmt er die Tochter eines Fürsten der slawischen Abodriten zur Frau, eines mächtigen Stammes im heutigen Holstein und Mecklenburg – und Feindes Ottos.
Aus Furcht vor einem Angriff lässt Harald um 968 das Danewerk ausbauen, mit Palisaden verstärken und an den Schutzwall heranführen, der seit Kurzem Haithabu umgibt. Doch zum Krieg kommt es erst Jahre später – nachdem sich der Däne Teile Norwegens unterworfen hat.
Das bergige Land mit seiner langen, zerfurchten Küstenlinie ist schwer unter Kontrolle zu bringen und zerfällt zu Beginn der Wikingerzeit in eine Vielzahl von Herrschaftsgebieten. Zwar gelingt es König Harald Schönhaar um 880, große Teile Norwegens zu vereinen. Doch der Norden bleibt unabhängig, über ihn gebieten die Jarle von Lade, eine bei Trondheim beheimatete, mächtige Häuptlingssippe.
Frieden jedenfalls findet Norwegen nicht. Um 955 erheben sich die Enkel Harald Schönhaars gegen einen neuen Herrscher, der sich den Thron mit Gewalt erobert hat – und bitten einen mächtigen Verwandten um Unterstützung: Harald Blauzahn, den Bruder ihrer Mutter.
Der Däne verhilft seinen Neffen zur Macht und setzt einen von ihnen auf den Thron. Doch der neue norwegische Machthaber regiert aus seiner Sicht schon bald zu unabhängig und entgegen seinen Interessen. Um 965 verbündet sich Harald daher mit Haakon, dem Jarl von Lade, tötet seinen Cousin – und sieht sich fortan als Herrscher der Norweger.
In jenen Jahren lässt der Dänenkönig neben dem Grabmal seines Vaters in Jelling einen zweiten, noch größeren Hügel auftürmen. Dieser dient wohl einzig dazu, auf den gewaltigen Runenstein aufmerksam zu machen, den Harald genau zwischen den beiden Erhebungen platzieren lässt: ein ebenso kunstvolles wie kryptisches Zeugnis des Zeitenwechsels in Dänemark, ein Monument, auf dem eine gemeißelte Inschrift von Haralds Ruhm als erster christlicher Herrscher Dänemarks und Eroberer Norwegens kündet, auf dem eine Schlange mit einem Fabelwesen kämpft und ein Löwe mit Pferdemähne vor Christus seine Pfote hebt.
Nun, da Harald seine Macht in Südnorwegen gefestigt wähnt, setzt er den Jarl von Lade als seinen Stellvertreter ein, sichert sich dessen militärische Unterstützung und fällt 974, ein Jahr nach dem Tod Ottos I., in die Reichsgebiete südlich der Eider ein. Mag er sich zur Loyalität gegenüber Otto I. verpflichtet gefühlt haben – Harald ist offenbar nicht bereit, dessen Nachfolger in gleicher Weise zu dienen.
Doch im Kampf mit Otto II. unterliegt der Dänenherrscher. Bei einem Gegenschlag nehmen die Soldaten des mächtigen Kaisers sogar das Danewerk ein, auch Haithabu fällt in ihre Hände.
Es folgen schwere Jahre für den König. Der Süden seines Landes bleibt von Otto II. besetzt, fremde Wikingerflotten suchen wiederholt die dänischen Küsten heim – und im Norden verweigert ihm schon bald Haakon die Gefolgschaft. Zum Bruch führen vor allem Haralds Missionierungsversuche, denen sich der Jarl von Lade – obwohl selbst getauft – zunehmend widersetzt: Er wendet sich vom Christentum ab und betet wieder die alten Götter an.
Mit einer Armee fällt Harald Blauzahn daraufhin in Norwegen ein, verheert das Land und verschont nur fünf Bauernhöfe – so überliefert es eine Saga. Doch ist die Schilderung dieses Rachezuges wenig glaubwürdig, denn am Ende verliert der Herrscher den Kampf: In einer Seeschlacht vor Hjorungavag in Westnorwegen werden die Dänen von einer Flotte des abtrünnigen Jarls besiegt.
Harald Blauzahn ist zweifelsohne geschwächt. Doch er reagiert auf die Bedrohungen seines Reiches geradezu kühn – mit einem einzigartigen Bauprogramm. Denn er weiß, dass sich ein großes und zentral regiertes Territorium nur mithilfe gut ausgebauter Straßen, Brücken sowie Burgen zusammenhalten lässt. Und mit Soldaten.
Jütlands Haupttrasse, die auch Ochsenweg genannte Heerstraße, ist bisher nicht mehr als ein breiter Trampelpfad. Andere Straßen enden nicht selten an Seen oder Flüssen, die nur mit einer Fähre oder an einer Furt durchquert werden können. Und im Winter kämpfen sich Menschen auf Ski und mit Schlitten mühevoll durch Schnee und Eis.
DÄNEMARK, IN EINEM WINTER um das Jahr 980. Aus den Wäldern Ostjütlands dringt der Klang von Tausenden Axthieben: Der König lässt mindestens 300 Hektar Wald fällen und die mehr als 500 Jahre alten Eichenstämme zu den Weiden südlich von Jelling transportieren. Bald darauf spannt sich bei dem heutigen Ort Ravning eine gewaltige Holzkonstruktion über die weite Niederung des Flusses Vejle und macht das sumpfige Gebiet bei jeder Witterung passierbar: 760 Meter lang, mehr als fünf Meter breit, getragen von 280 Pfostenreihen – die größte Brücke Dänemarks.
Im Abstand von knapp zweieinhalb Metern ziehen sich die Pfosten in perfekten Linien durch das Tal; auf der gesamten Länge weicht kein Stamm mehr als fünf Zentimeter vom zuvor festgelegten Verlauf ab.
Ein vierjähriges Kind folgt Otto II. auf den Thron
Wahrscheinlich macht die Brücke schnellere Truppenbewegungen möglich. Harald Blauzahn rüstet nun auf – und plant einen Krieg gegen den römisch-deutschen Herrscher. 983, als die Truppen Ottos II. in Kalabrien von den Sarazenen besiegt werden, sieht der Däne seine Chance gekommen. Er erobert Haithabu und das Grenzland zurück, während sein mit ihm verbündeter Schwiegervater, der Fürst der Abodriten, zeitgleich Holstein plündert und Hamburg angreift. Auch eine von Otto II. angelegte Burg nördlich der Eider nimmt Harald ein und brennt sie nieder; was der Kaiser 974 gewonnen hatte, verliert er ein knappes Jahrzehnt später im Handstreich.
Einen Gegenangriff muss der König nicht fürchten: Otto II. stirbt noch im selben Jahr, ein vierjähriges Kind folgt ihm auf den Thron. Keine Gefahr für Dänemark.
Harald Blauzahn hat sein Reich inzwischen zudem durch weitere spektakuläre Bauten gesichert: ringförmige Festungen, die seine Macht wohl nicht nur nach außen, sondern auch gegen Feinde im Inneren schützen sollen. Deren genaue Funktion jedoch bis heute unklar ist.
Sie entstehen um 980 im gleichen Zeitraum an fünf Orten Dänemarks. Keine der Festungen erhebt sich direkt an der See, alle jedoch sind über Flüsse und Fjorde mit dem Meer verbunden. Wie gewaltige, kreisrunde Amulette liegen die Burgen, aus der Luft betrachtet, in der Landschaft: Jede Anlage besteht aus einem exakt gezirkelten Ringwall mit einem Durchmesser zwischen 120 und 240 Metern, in den vier gleichweit voneinander entfernte, in die vier Himmelsrichtungen weisende Tore Einlass gewähren. Zwei mit Holzbohlen ausgelegte, schnurgerade Hauptwege zerteilen die Anlage in gleichmäßige Viertel, in denen wiederum vier Langhäuser ein Quadrat bilden.
Eine dieser Burgen ist die Trelleborg auf Seeland. Sie erhebt sich auf einer Landzunge zwischen zwei Wasserläufen, die sich hinter der Festung treffen und später in den Gro-ßen Belt münden, die Meeresstraße zwischen Seeland und Fünen. Über fast zwei Hektar Land erstreckt sich die Anlage, der ein weiterer Wall vorgelagert ist.
Tausende Arbeiter erfordert der Bau – vor allem wohl Sklaven. Denn schwere Arbeit lassen die Wikinger oft von Unfreien erledigen, die sie auf Raubzügen gefangen und nach Skandinavien verschleppt haben – Menschen mit geschorenen Köpfen und aufgeschnittenen Nasenflügeln, die ihren Status markieren.
Allein um den Bauplatz für die Trelleborg einzuebnen, müssen die Arbeiter 8000 Kubikmeter Lehmboden bewegen. Mit Holzspaten heben sie anschließend die Erde für einen gewaltigen Wallgraben aus. Sie verlegen Zehntausende Quadratmeter Grassoden, verbauen Tausende Kubikmeter Steine und Eiche, aus denen Palisaden, Wege und Häuser entstehen.
Mögen die Mittel einfach sein, die Präzision der Arbeit ist enorm. Ein Grund ist, dass die Burg offenbar exakt geplant worden ist – in einer neuen, konsequent angewandten Maßeinheit, die Spezialisten wohl eigens festlegen; 49,3 Zentimeter misst die "Trelleborg-Elle".
Diese Einheit entdecken Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedoch erst rund 1000 Jahre später, nach der Computeranalyse von Grabungszeichnungen. Ähnlich spät stoßen sie auf eine Stätte mit 135 Gräbern, darunter drei Massengräber, in dem die Überreste von Männern zwischen 20 und 35 Jahren lagen. Möglich, dass es sich um gefallene Krieger handelt, denn einem der Toten wurde das Bein oberhalb des Knies abgetrennt – war die Trelleborg also Schauplatz eines militärischen Kampfes?
In den Gräbern fanden sich auch Knochen von älteren Männern, Frauen und Kindern, in anderen Bereichen des Geländes zudem Sensenblätter, Fischhaken, Schmiedewerkzeuge, Spinn- und Webgeräte. Zeugnisse eines friedvollen Alltags? Beweise, dass die Ringburgen keineswegs nur als Kasernen dienten? 750 Menschen, so schätzen Archäologen, lebten wohl zur Hochphase in der Anlage – Soldaten, Bauern, Handwerker, ganze Familien.
Vielleicht nutzte Harald die königlichen Festungen auch als Verwaltungszentralen. Denn sie finden sich in allen dicht besiedelten Regionen Dänemarks. Ließ der König etwa von der Trelleborg aus Steuern eintreiben, die Abgaben womöglich dort lagern?
Sicher scheint, dass die Ringburg nur wenige Jahre genutzt und dann für immer verlassen wird. Wie ein Relikt aus anderen Zeiten mag das Bauwerk noch eine Weile aus den Sümpfen Seelands ragen, bis alles Holz verrottet ist – nur einige Überreste der Wallanlagen bleiben erhalten. Auch die gewaltige Brücke, die Harald Blauzahn über die Niederung der Vejle spannen ließ, verfällt wohl binnen kurzer Zeit. Denn eine Holzbrücke muss im Abstand von zehn bis 15 Jahren repariert werden; die Konstruktion in Jütland aber wurde es nie, wie Archäologen festgestellt haben.
DOCH WARUM STECKT HARALD BLAUZAHN so viel Geld und Arbeitskraft in Bauten, die dann so rasch wieder aufgegeben werden? Regt sich Widerstand gegen seine Projekte, den hohen Aufwand, den er treibt?
Um 987 kommt es jedenfalls zu einer Rebellion gegen den dänischen König, angeführt von dessen eigenem Spross – Sven Gabelbart. Mag sein, dass der Sohn Gegner seines Vaters hinter sich vereint, die sich gegen steigende Abgaben und Zwangsarbeit wehren. Denn der Thronerbe hat eine andere Vorstellung davon, wie sein Vater das Reich finanzieren sollte – nämlich durch massive Raubfahrten nach England.
Oder aber initiiert Sven Gabelbart den Aufstand, weil sich Harald Blauzahn weigert, seine Macht mit ihm zu teilen? Weil der Vater dem ungeliebten, mit einer Konkubine gezeugten Kind, das im Mannesalter nur plündernd umherzieht und im In- und Ausland brandschatzt, das Erbe nicht gönnt?
Harald Blauzahn stirbt um das Jahr 986 im Exil
Welchen Grund es auch geben mag: Am Ende zieht der Sohn gegen den Vater in die Schlacht. Laut einer Saga verbündet sich Sven dafür mit einem Kriegsgesellen, den Harald einst auf die Probe gestellt und zutiefst gedemütigt hat: Palna-Toki. Im Isefjord im Nordwesten der dänischen Insel Seeland wartet auf die Krieger bereits die Flotte des Königs. Nach schweren Gefechten muss Sven zwar fliehen, doch sein Vater wird am Ende von einem Pfeil Palna-Tokis getroffen.
Doch auch andere Quellen berichten zumindest von einer tödlichen Kampfverletzung Haralds, der noch aus Dänemark fliehen kann – vielleicht zum Stamm seiner Frau oder in eine Wikingersiedlung an der Odermündung, wie es ein Chronist nahelegt. Er stirbt um das Jahr 986 im Exil.
Gefolgsleute überführen seinen Leichnam in die Heimat und setzen ihn in einer Kirche bei, die Harald einst auf einem Hügel am Roskildefjord auf Seeland errichten ließ. Heute erhebt sich an jener Stelle der Dom von Roskilde – die Grablege von 40 Königinnen und Königen, die dem ersten christlichen Herrscher Dänemarks seither auf den Thron gefolgt sind; 30 Generationen, über die das dänische Königshaus bis heute mit der Dynastie von Jelling verbunden ist.
Diese erfährt schon bald eine weitere Blüte: Sven Gabelbart gründet nicht nur die spätere schwedische Stadt Lund, sondern erobert England und lässt sich dort 1013 zum König proklamieren. Doch erst Harald Blauzahns Enkel, Knut dem Großen, gelingt es, die dänische Herrschaft über Norwegen und England (sowie über Teile Schwedens) zu festigen.
Knut ist der wohl erste Wikinger, den die Großen Europas in ihren Kreis aufnehmen. Der römisch-deutsche König Konrad II. lädt ihn gar zu seiner Kaiserkrönung im Jahr 1027 nach Rom ein – neben deutschen und italienischen Fürsten, Großäbten, Bischöfen und dem König von Burgund.
Zwar zerfällt das dänische Imperium wenige Jahrzehnte später wieder, brechen zwischen rivalisierenden Linien der Jelling-Dynastie Machtkämpfe aus. Und im Jahr 1066 brennen slawische Krieger Haithabu nieder; die Überlebenden des Infernos treiben nun am anderen Ufer der Schlei im heutigen Schleswig Handel.
Und doch sieht Dänemark am Ende der Wikingerzeit einer verheißungsvollen Zukunft entgegen. In dem von Harald Blauzahn begründeten Reich blüht die Landwirtschaft auf, entstehen reiche Agrargüter, mehr und mehr Städte.
Und 1104, 139 Jahre nach Haralds Taufe, erhebt Rom das im dänischen Schonen gelegene Lund zum Erzbistum – dem fortan sämtliche Kirchen Nordeuropas unterstehen.