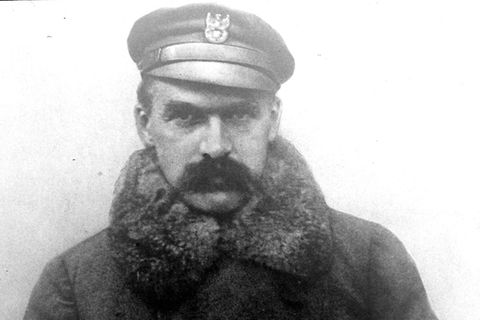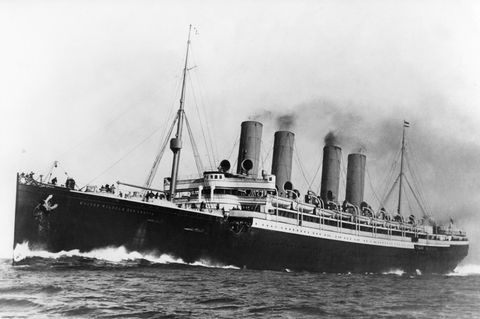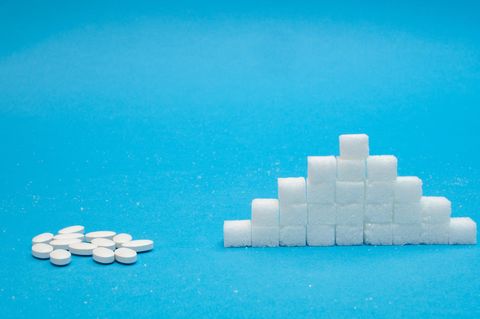GEO plus
Jetzt testen
Weiterlesen mit GEO+
4 Wochen für 1 €. Jederzeit kündbar.
Bereits registriert?
Erschienen in GEO Epoche Nr. 14 (2004)