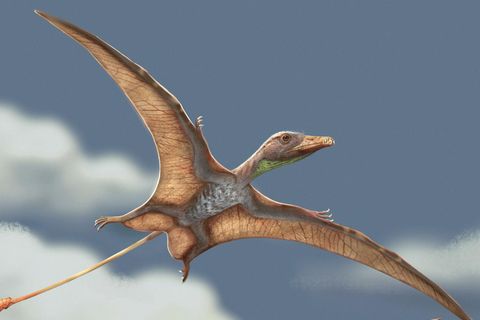Paläontologische Sensationen können überall warten, bewies zuletzt ein achtjähriger Schüler aus Österreich: In einer Baugrube in Mattersburg nahe der ungarischen Grenze sah der Junge Anfang November ein merkwürdiges Gebilde im Erdreich. Es entpuppte sich als Mammut-Stoßzahn – 1,80 Meter lang, außerordentlich gut erhalten, mutmaßlich zehntausende Jahre alt.
Geborgen und abtransportiert, befindet sich das Fundstück jetzt am Institut für Paläontologie der Universität Wien. Hier untersuchen Forschende den Zahn, um neue Erkenntnisse über das Leben der eiszeitlichen Elefanten in Europa zu gewinnen.
Mammut ist nicht gleich Mammut
Vor allem eine Frage beschäftigt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Stammt der Zahn von einem Wollhaarmammut? Oder saß er im Maul eines Steppenmammuts? Letzteres war mit einer Schulterhöhe von bis zu 4,50 Meter eines der größten Rüsseltiere, die je auf der Erde gelebt haben und streifte wohl vor erstmals 750.000 Jahren durch Europa, Asien und Nordamerika.
Vor rund 250.000 Jahren löste das etwas kleinere Wollhaarmammut das Steppenmammut ab. "Wahrscheinlich stammt der Zahn eher von einem Wollhaarmammut. Sollte er älter sein und von einem Steppenmammut stammen, wäre es aber eine Sensation", sagt die Paläontologin Doris Nagel von der Uni Wien. Denn von dieser Art konnten bislang in Europa kaum Funde geborgen werden, in Österreich gar keine. In Deutschland gibt es nur ein einziges rekonstruiertes und aufgebautes Skelett, es befindet sich im Spengler-Museum in Sangerhausen.
Mit Hilfe eines zusätzlichen Backenzahns ließe sich leicht bestimmen, von welcher Mammutart der Stoßzahn stammt. Allerdings: "Da der Zahn unter den Lössschichten in einer groben Schotterschicht geborgen wurde, dürfte es sich leider um ein verfrachtetes Element handeln", sagt Nagel. Der Stoßzahn sei vermutlich gemeinsam mit dem Schotter bei einem Starkwasserereignis am Fluss Wulka vor einigen tausenden Jahren angeschwemmt worden. "Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sich weitere Reste in unmittelbarer Umgebung befinden", so die Paläontologin weiter.
Zunächst werden die Forschenden eine Radiokarbondatierung (C14) durchführen. Mit diesem Verfahren lässt sich das Alter organischer Materialien aber nur für einen Zeitraum von bis zu 50.000 Jahren feststellen. Sollte der Zahn von Mattersburg älter sein, wollen die Fachleute eine Uran-Blei-Datierung vornehmen – eine Methode, mit der in der Vergangenheit etwa das Alter des Sonnensystems bestimmt wurde.

Daneben erhoffen sich die Forschenden auch konkrete Einblicke in das Leben der Mammuts. "Wir wissen, dass die Tiere je nach Nahrungsangebot große Strecken zurückgelegt haben", sagt Doris Nagel. "Aber auf welchen Routen sie durch Europa zogen, ist bislang kaum erforscht". Da der Wasserspiegel in jener Zeit sehr niedrig war, hätten Mammuts theoretisch von der heutigen Ukraine bis nach England streifen können. Der Stoßzahn soll helfen, die Wanderungsbewegungen der Mammuts nachzuvollziehen. "Im Zahn bildet sich ab, in welchen Regionen das Tier Wasser getrunken hat", so Nagel. Sie geht davon aus, dass die Untersuchungen mehrere Monate dauern werden.
Die meisten Wollhaarmammut-Populationen starben vor etwa 10.000 Jahren aus. Nur auf der Insel Wrangel im Nördlichen Eismeer lebten die Riesentiere isoliert noch weitere 6000 Jahre.