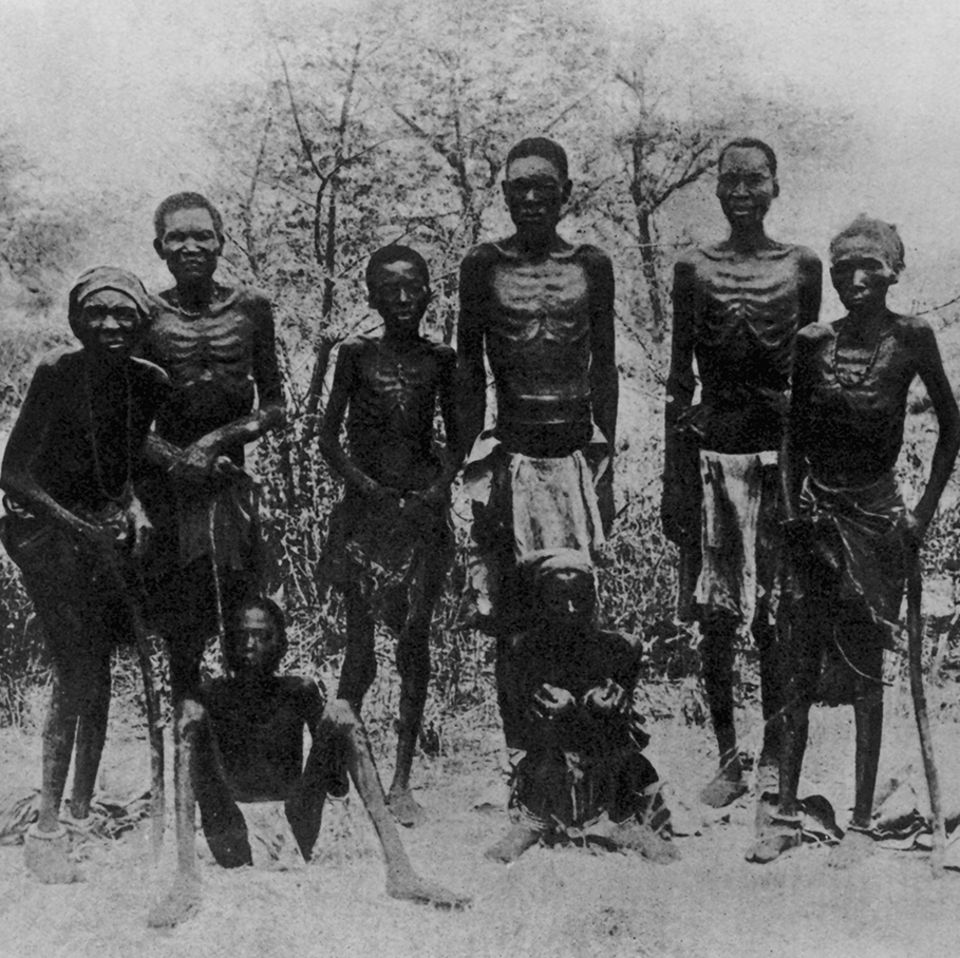Die Bewohner von Elba haben sich angestrengt. Sie haben Goldpapier auf das hastig gezimmerte Podium geheftet. Und ein altes Sofa gefunden: Der neue Herr der Insel braucht ja einen Thron. Über Nacht hat der Bürgermeister von Portoferraio, dem Hauptort Elbas, noch seine Kellerschlüssel vergolden lassen. Die reicht er dem Fürsten nun in einer silbernen Schale – als Zeichen für die Übergabe der Insel. Von den rund 14000 Bewohnern sind die meisten zum Empfang ihres neuen Herrn gekommen. Aus ihren Kehlen dröhnt auf einen Wink nun ein „Evviva l’imperatore“, es lebe der Herrscher.
Selbst wenn er im Innersten noch Illusionen über sein weiteres Schicksal hatte – dieser groteske Willkommensgruß am 4. Mai 1814 führt Napoleon die ganze harte Wahrheit vor Augen: Nur Wochen nach seiner erzwungenen Abdankung als Herrscher Frankreichs ist er zum Gebieter eines „Operettenkönigreichs“ herabgesunken. So formuliert er es selbst voller Sarkasmus.
Elba, ein karges Eiland vor der italienischen Westküste, misst an seiner längsten Stelle nicht einmal 30 Kilometer. Eine „sicherlich sehr kleine Insel“, wie Napoleon gedankenverloren eine Woche nach seiner Ankunft bekennt. Viel zu klein für die Ambitionen und den Stolz des gestürzten Kaisers der Franzosen, des einstigen Herrn Europas, des Weltenherrschers.
Doch die anderen europäischen Mächte haben nun das Sagen, und die haben ihn hierher verbannt. Um ihn endgültig unschädlich zu machen. Er darf Besucher empfangen, aber die Insel nicht verlassen. Formal ist Napoleon weiterhin Kaiser, Herr jedoch nur noch über das kleine Elba. Der französische Staat sichert sein Auskommen.
Napoleon mag gedemütigt sein – gebrochen aber ist er nicht. Und so macht er sich, unermüdlich und wie immer mit eisernem Willen, an die Arbeit. Er lässt das alte Gerichtsgebäude zum Palast herrichten (für seine österreichische Frau Marie-Louise und seinen Sohn, die der habsburgische Kaiser jedoch nach Wien bringen lässt) und ordnet die Ausbesserung der von Schlaglöchern übersäten Inselstraßen an. Elbas Saline und die Hafenanlagen werden modernisiert, neue Flächen für Weizenfelder ausgewiesen, die kargen Wälder gepflegt. Sogar einen Staatsrat gründet er.
Und den Gästen in seinem Miniaturreich – meist neugierige Touristen aus England, die er leutselig empfängt – versichert er: „Ich beschäftige mich nur mit meiner Familie und meinem Ruhesitz, meinen Kühen und Eseln. Ich denke an nichts außerhalb meiner kleinen Insel.“
Nichts aber ist weiter von der Wahrheit entfernt. Denn tatsächlich lässt sich Napoleon ununterbrochen über die Vorgänge in der Heimat unterrichten.
Napoleon leitet eine Invasion des eigenen Heimatlandes
Ludwig XVIII., der Bruder des in der Revolution guillotinierten Ludwig XVI., hat den Thron seiner Vorfahren eingenommen. Doch hat es der Bourbonen-König binnen weniger Monate verstanden, seine Untertanen gegen sich aufzubringen.
Die Menschen in Paris murren, sie haben keine Arbeit. Die Bauern auf dem Land fürchten die Rückkehr der alten Abgaben aus der Zeit vor der Revolution. Frankreichs Heer von 500.000 Mann hat der König mehr als halbiert: Eine Viertelmillion Soldaten und 12.000 Offiziere stehen ohne Lohn und Brot da. Die Kornpreise steigen. Die Steuern auch.
Im Februar 1815, zehn Monate nach Napoleons Sturz, neun nach seiner Ankunft auf Elba, eskalieren die Ereignisse: Trotz seiner Bewacher – Franzosen und Österreicher haben Spitzel auf der Insel eingesetzt, die Briten einen Oberst als offiziellen Aufpasser – erreicht ein im Schutz der Nacht eingeschmuggelter Bote den Kaiser. Der Informant berichtet von Gerüchten, in Paris stehe ein Staatsstreich bevor.
Der ungeliebte König (der so feist ist, dass er sich in einem Rollstuhl durch seinen Palast schieben lässt) soll durch seinen jüngeren Bruder abgelöst werden, um das Ansehen des Hauses Bourbon zu retten. Gleichzeitig erreichen Napoleon Hinweise, dass die Beratungen auf dem Wiener Kongress nicht vorankommen.
Die Koalition der europäischen Großmächte, die ihn in die Knie gezwungen hat und in Österreichs Hauptstadt gerade über die Neuordnung des Kontinents verhandelt, scheint sich wieder aufzulösen.
Napoleon will erneut zum Kaiser gekrönt werden
Napoleon sieht seinen Moment gekommen. Noch einmal will er zuschlagen, nach der Macht greifen, der Macht in Frankreich. Noch einmal die Ehre retten, seine eigene und die des Vaterlandes. Noch einmal soll sich stolz der Adler in die Lüfte schwingen, das Symbol seiner Armee. Er will wieder in den Strahlen des Ruhms stehen – er, Napoleon, Kaiser der Franzosen, l’Empereur.
Er weiß, dass ihm nur eine kurze Frist bleibt. Entweder kann er sein Schicksal jetzt schnell wenden, oder er wird untergehen. Aber Napoleon – gerade erst 45 Jahre alt – ist ein Spieler. Und er geht stets auf das volle Risiko. Das Unmögliche, das Unerreichbare fordert ihn geradezu heraus.
Immer wieder ist das so gewesen. Richtung Indien ist er aufgebrochen. Die Britischen Inseln wollte er erobern. Bis nach Moskau hat er seine Armee geführt. Dreimal ist er gescheitert. Diesmal soll ihm das Undenkbare gelingen: die Invasion des eigenen Heimatlandes und die Rückkehr auf den Kaiserthron in Paris – gegen den Willen der Völker Europas.
Gut 100 Tage werden ihm am Ende bleiben für die letzte Eskapade, mit der er die Welt in Atem hält. Heimlich lässt er im Hafen von Portoferraio sieben Schiffe beladen: mit Musketen und Munition, Geschützen, Proviant, Lastpferden.
Am 26. Februar gibt er den Befehl zum Aufbruch: 1026 Mann schiffen sich mit ihm ein, unter ihnen Hunderte Getreue seiner Garde, die ihm im Mai ins Exil auf die Insel gefolgt sind. Die Siegermächte hatten ihm die kleine Truppe samt Ausstattung zur Verteidigung der Insel gegen Piraten zugestanden.
Am Abend setzt sich die Flottille in Bewegung. Niemand hindert ihn. Napoleons britischer Aufpasser ist Tage zuvor zu seiner Geliebten aufs italienische Festland gesegelt. Der Flug des Adlers hat begonnen.
"Ich will die Krone zurück, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen."
Am 1. März erreichen die Schiffe den Golf von Juan an der französischen Mittelmeerküste. Napoleon lässt die Trikolore, die Fahne der Republik, an den Heckmasten hissen. Am hellen Tag waten seine Männer an Land, kampieren in der Nacht darauf für ein paar Stunden vor Cannes. Nirgendwo stoßen sie auf ernsthaften Widerstand: Ein Küstenfort ist nicht besetzt, die kleine Garnison in Antibes umgehen sie.
Ein größeres Truppenkontingent steht in Nizza. Das schickt nun einen Boten nach Paris, aber greift nicht an. „Vergesst nicht“, mahnt Napoleon die Soldaten, „ich will meine Krone zurückgewinnen, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen.“
Seine Spitzel haben ihm berichtet, dass die Erbitterung in Frankreich ihm gegenüber, ja der Hass, der ihm auf seinem Weg ins Exil entgegengeschlagen war, verflogen sei. Er würde willkommen geheißen. Und niemand außer den Stützen des Bourbonen-Regimes, den Aristokraten und den Priestern, werde sich ihm in den Weg stellen.
Tatsächlich hört er schon am zweiten Abend erstmals wieder den vertrauten Ruf: „Vive l’Empereur.“ Ein blinder Veteran hat ihn angestimmt. Napoleon umarmt den Alten gerührt.
Er will direkt nach Norden, den Weg durch die Voralpen nehmen. So hofft er, am schnellsten voranzukommen und auf die geringste Gegenwehr zu stoßen. Über schmale Gebirgspfade, durch Schnee und Eis schleppt sich das Expeditionskorps Richtung Paris.
Im Örtchen Gap empfangen den Kaiser erstmals begeisterte Massen. Nationalgardisten treten unter Trommelschlag an. Freudenfeuer prasseln. Die Menschen tanzen. Überall ist die Trikolore gehisst, das weiße Lilienbanner der Bourbonen verschwunden. Nach nicht einmal einem Jahr unter deren Regiment sind die Menschen bereit, Napoleon eine neue Chance zu geben.
Schnell verbreitet sich im Süden Frankreichs die Kunde von seiner Landung. Die königlichen Truppen sind alarmiert. Doch erst kurz vor Grenoble stellen sich ihm Soldaten in den Weg.
Napoleon marschiert an der Spitze seiner Garde auf sie zu. Der Offizier der Königlichen erteilt den Schießbefehl. Doch nichts geschieht.
Der einstige Herrscher zerrt seinen grauen Waffenrock auf und entblößt seine Brust. Dann ruft er den Royalisten zu: „Soldaten! Ich bin euer Kaiser. Ihr kennt mich. Wenn einer unter euch ist, der seinen Kaiser töten will, hier stehe ich.“
Mehr muss er nicht sagen. „Vive l’Empereur“, brüllen die Männer und reißen sich die Zeichen der Königstreuen von ihren Kappen. Ihre Freudenrufe hallen durch das Gebirgstal.

Am Abend zieht Napoleon kampflos in Grenoble ein. Die Militärkapelle spielt die Marseillaise. „Allons enfants de la Patrie!“ Die gesamte Garnison läuft zum Kaiser über. 8000 Mann hören nun auf sein Kommando. Begeistert.
Es ist der 7. März. Nicht einmal eine Woche ist Napoleon wieder im Lande. In Paris hat der Hof die Landung zunächst als Verzweiflungstat eines Wahnwitzigen abgetan. Doch nun soll der jüngere Bruder des Königs, der Comte d’Artois, sich dem Usurpator persönlich in den Weg stellen, vor Lyon, an der Spitze getreuer Truppen.
Aber die dortigen Soldaten und ihre Offiziere verweigern den Gehorsam. Der Comte muss fliehen. Napoleons Einmarsch in Frankreichs zweitgrößte Stadt gleicht einem Triumphzug. Und wieder ist nicht ein Schuss gefallen. 14.000 Mann folgen dem Mann aus Elba nun schon. Eine kleine Armee.
Der selbst gekrönte Kaiser wird zum Mann des Volkes
In Lyon macht Napoleon Pause. Die Zeit der Politik ist gekommen. Die Armee, das spürt er, hat er für sich gewonnen. Und die Menschen lassen sich begeistern, wie er auf dem Weg erleichtert, aber zugleich mit Schrecken beobachtet hat. Der ehemalige Herrscher verachtet ja im tiefsten Herzen die Masse. Er weiß, dass er sich auf sie nicht verlassen kann, auch wenn er sie jetzt braucht.
Um sie endgültig auf seine Seite zu ziehen, vor allem aber um Frankreichs selbstbewusste Bürgerliche zu gewinnen, die der zurückgekehrte Bourbonen-König schwer enttäuscht hat, leistet er nun ein feierliches Versprechen: „Ich komme zurück, um die Errungenschaften, die uns unsere Revolution gegeben hat, zu schützen und zu verteidigen“, proklamiert er in Lyon. „Ich will euch eine unverletzliche Verfassung geben, ausgearbeitet gemeinsam vom Volk und mir.“
Noch im Mai sollen 30.000 Delegierte in Paris zu einer verfassunggebenden Versammlung zusammenkommen, verspricht er. Eine große Geste. Ausgerechnet er, der selbst gekrönte Kaiser, der bürgerliche Freiheiten unterdrückt und einen Polizeistaat errichtet hat, er, der nichts gelten ließ außer seinem Willen, gerade er gibt nun vor, kaum mehr sein zu wollen als das ausführende Organ von Volkes Willen.
Es ist der 11. März, und der Hof in Paris wird unruhig. Aber noch haben die Royalisten Marschall Michel Ney. Der gehörte zu den ersten der Generäle Napoleons, die 1814, als sich die Niederlage ihres Oberbefehlshabers und Förderers abzeichnete, von der Fahne gingen. Nun verspricht er, ihn „lebend in einem eisernen Käfig nach Paris zurückzubringen“.
Doch dann zählt der nüchterne Ney seine Soldaten. Und schreibt dem Mann, den er gerade eben noch wie ein wildes Tier fangen wollte, einen Brief: Am Morgen des 18. März umarmt Napoleon in Auxerre seinen abtrünnigen General. Ney ist mit seinen Truppen zu ihm übergelaufen. 20.000 Mann hören jetzt auf Napoleons Kommando. Nach Paris sind es nur noch 170 Kilometer.
In hundert Tagen rüstet Napoleon sein Heer für den Krieg
Am Abend, kurz vor Mitternacht, flieht Ludwig XVIII. in Richtung Flandern. Zwei Tage später, am 20. März, zieht Napoleon in Paris ein; kein Schuss ist seit der Landung an der Mittelmeerküste gefallen. Der Jubel der Massen hat seit Lyon noch zugenommen. Zehntausende säumen seinen Weg und rufen frenetisch „Vive l’Empereur“.
Um 21.00 Uhr fährt die schlammbespritzte Kutsche des Rückkehrers in den Tuilerien vor, vorbei an Nationalgardisten, die das Gewehr präsentieren. Soldaten tragen ihn auf den Schultern die Prachttreppe hinauf in den Palast. In seinem alten Arbeitszimmer lässt er Papiere des Vorgängers zur Seite räumen und eine Karte Frankreichs aufhängen. „Dem Volke, der Armee verdanke ich alles“, sagt er seinen Begleitern.
Napoleon ist an diesem Abend auffallend blass, geradezu totenbleich. Es bleiben ihm noch 94 Tage.
Der Kongress zur Neuordnung des Kontinents, zu dem der Habsburger Monarch Abgesandte aus ganz Europa nach Wien geladen hat, tagt zu diesem Zeitpunkt noch immer und ist keineswegs so gespalten, wie Napoleon vermutet hatte – eine folgenschwere Fehleinschätzung.
Denn die vier Siegermächte von 1814 (Russland, Preußen, Österreich, Großbritannien) müssen nicht erst langwierig Depeschen von Hauptstadt zu Hauptstadt schicken, als die Nachricht von Napoleons Rückkehr eintrifft, sondern können sofort reagieren.
Sie handeln schnell und entschlossen. Bereits am 13. März 1815 erklären sie Napoleon zum internationalen Gesetzesbrecher und „Störer des Weltfriedens“. Knapp zwei Wochen später unterzeichnen die vier Mächte ihren siebten Koalitionsvertrag gegen den Usurpator. Vier Armeen wollen sie aufbieten und im Juli Frankreich angreifen. Mit Napoleon soll ein für alle Mal abgerechnet werden.
Der weiß, dass er nur eine Chance hat: Er muss schneller sein als seine Gegner. Öffentlich erklärt er, nichts als den Frieden zu wollen. Tatsächlich aber macht er sich sofort daran, Frankreichs Kriegsmaschinerie wieder anzuwerfen.
Als Kaiser, als der er sich erneut selbst eingesetzt hat, lässt er eine Verfassung ausarbeiten und die Wahlgesetze ändern. Aber 95 Prozent seiner Dekrete und Briefe in diesen furiosen fast 100 Tagen haben nur ein Thema: die Vorbereitung auf den großen Krieg.
Sechs Tage nach seiner Rückkehr veranlasst Napoleon die Neuordnung der Armee. Acht „Beobachtungskorps“ lässt er aufstellen – der Name soll seine angeblich friedlichen Absichten unterstreichen. Tatsächlich sind sie aber nichts anderes als die Neuauflage seiner alten Streitkräfte unter anderem Namen. Die Kavallerie allein wird 46.000 Mann umfassen.
Den Kern bildet die Armée du Nord. Sie soll am 10. Mai einsatzbereit sein. Denn nördlich der Grenzen ziehen Preußen und Briten bereits Truppen zusammen, unter Führung des preußischen Generalfeldmarschalls Gebhard Leberecht von Blücher und des britischen Feldmarschalls Arthur Wellesley, Duke of Wellington.
Zehntausende junger Männer werden in den 23 Militärbezirken Frankreichs eingezogen. Die Nationalgarde, das Bürgerheer von Reservisten, das während der Revolution geschaffen worden war, wird aktiviert: mehr als zwei Millionen Männer im Alter von 20 bis 60 Jahren.
Alles muss gleichzeitig geschehen und sofort. Die Armee braucht Waffen? 240.000 Musketen sollen binnen weniger Wochen hergestellt werden. Die staatlichen Manufakturen schaffen das nicht? „Wenn es an Fabriken mangelt, dann requirieren Sie eben Kasernen, Schlachthäuser, Kirchen, ja selbst Konzerthäuser dafür. Aber machen Sie was!“, herrscht Napoleon seinen Kriegsminister an.
Uniformen und Stiefel fehlen für die Rekruten? „Ich habe 100.000 Mann in den Rekrutierungszentren, aber ich kann sie nicht einsetzen, weil ich kein Geld für ihre Uniformen und Ausrüstung habe“, beklagt sich der Kaiser beim Schatzminister. Der treibt doch noch ein paar Reserven auf, und binnen Kurzem schneidern Manufakturen in Paris und Umgebung 1250 Uniformen pro Tag.
Paris ist ungeschützt? 5000 Arbeiter werden beordert, um die Befestigungsanlagen der Stadt auszubauen; 4000 sind es in Lyon.
Dabei sind die Finanzen des Landes zerrüttet. Aber das interessiert den Kaiser nicht. Unter 300 Millionen Francs lag das Jahresbudget Ludwigs XVIII. Diese Summe und mehr braucht Napoleon jetzt allein für die Armee. Er wird die Steuern erhöhen müssen. Der Verkauf von Immobilien im Staatsbesitz, von Wäldern und Holz, soll 440 Millionen Francs bringen, eine Fantasiesumme.
Zudem müssen noch immer Schulden aus seinen vorangegangenen Kriegen bedient werden. Die Lage ist dramatisch. Die meisten Schiffe der Marine werden eingemottet. Sie kosten nur Geld und können gegen die Briten ohnehin nichts ausrichten. Die Kanonen werden zu den Bastionen entlang der Küste und ins Innere des Landes gebracht.
Das Versprechen, den Franzosen ihre bürgerlichen Freiheiten zurückzugeben, gerät schnell in Vergessenheit. Zwar lässt Napoleon eine Verfassung schreiben, die seine einst unbeschränkte Macht stark beschneidet und dem Parlament gesetzgeberische Vollmachten verleiht. Aber eine Beratung des Entwurfs verhindert er – das Volk soll sofort abstimmen.
Das Ergebnis des Referendums Ende April ist grotesk gefälscht. Nur 4802 von 26 Millionen Franzosen stimmen angeblich gegen die Verfassung von Napoleons Gnaden.
Napoleon wirkt alt, verbraucht und gealtert
Die trunkene Begeisterung über die Rückkehr Napoleons hat rasch tiefer Ernüchterung Platz gemacht. Frankreich ist kriegsmüde. Mindestens 900.000 Franzosen haben in seinen Feldzügen ihr Leben verloren. Die Nation, die der Kaiser zurück zum alten Glanz führen will, verweigert sich. Anfang April entlässt sein Innenminister 61 von 87 Präfekten, da sie Anweisungen nicht folgen, am 20. April alle Bürgermeister.
Richter lehnen den Eid auf den Kaiser ab. In Gymnasien sträuben sich Schüler gegen den Ruf „Vive l’Empereur“. In Poitiers zerschmettern aufgebrachte Bürger eine Büste des Kaisers. Armeeoffiziere werden beschimpft, manche erhalten Morddrohungen. Bei Demonstrationen im ganzen Land rufen Gegner der Bonapartisten „Napoleon an den Galgen“ und „Ein Hoch auf die Königstreuen“. Auf den Mauern des Tuilerien-Palasts kleben Plakate mit der Aufschrift: „Zwei Millionen Francs Belohnung für jeden, der den Frieden wiederfindet, der am 20. März verloren ging“ – dem Tag der Rückkehr Napoleons nach Paris.

Bereits Anfang April ist es im Westen des Landes zu ersten Attacken der Royalisten gekommen. Napoleon muss im Mai mehr als 20.000 Soldaten dorthin abkommandieren, um die Rebellion niederzuschlagen. Und am 22. des Monats ordnet er den Abtransport von 100 Tonnen Schießpulver und 500.000 Schuss Munition aus Marseille an, weil die Situation in der südfranzösischen Hafenstadt außer Kontrolle zu geraten droht. Das Land steht vor einem Bürgerkrieg.
Selbst unter Napoleons Getreuen wachsen die Zweifel. Der Innenminister Lazare Carnot fleht den Kaiser an, die Unzufriedenheit ernst zu nehmen: „Ihr Wohlbefinden und unseres auch hängen davon ab.“ Er mahnt vergebens.
Napoleon sei gegen jeden Ratschlag immun, schreibt sein Außenminister Armand de Caulaincourt. Hellsichtig analysiert der die Lage: Innenpolitisch gehe Napoleon „in die falsche Richtung“, wenn er dem Volk die versprochenen Freiheiten nicht gewähre. Und außenpolitisch nennt er dessen Vorgehen, sich mit ganz Europa anzulegen, schlicht „verrückt“. Napoleons früherer Polizeiminister Joseph Fouché hat schon im März prophezeit: „Die ganze Angelegenheit wird innerhalb von vier Monaten erledigt sein.“
Napoleon ist indes ohne Pause tätig. Drei Stunden Schlaf müssen reichen. Dann sitzt er wieder am Schreibtisch. Sein Arzt mahnt ihn zu mehr Ruhe. Der Kaiser ignoriert den Rat. Mehrere Zehntausend Menschen kommen am 1. Juni zu der von Napoleon versprochenen Verfassungsversammlung auf dem Marsfeld. Die Veranstaltung ist bombastisch inszeniert. Bei Napoleons Ankunft werden 600 Kanonen gleichzeitig abgefeuert. Entlang der Route stehen Soldaten mit Bajonetten.
Der Kaiser ist in ein blendend weißes Ornat gekleidet – dieselbe Robe, die er ein gutes Jahrzehnt zuvor bei seiner Selbstkrönung in Notre-Dame getragen hat, einschließlich des mit Straußenfedern geschmückten Samthuts.
Ein absurder Mummenschanz: Ausgerechnet an jenem Tag, an dem Frankreichs neue Verfassung gefeiert werden soll, trägt der Kaiser ein Kleid, das ein Symbol seiner Selbstherrlichkeit geworden war. Und alles ist viel zu klein; sein mächtiger Bauch droht die Nähte zu sprengen. Wie ein unübersehbares Zeichen, dass sich die Zeiten nicht mehr zurückdrehen lassen. Als spürte er das nur mühsam unterdrückte Murren der Massen, flieht Napoleon vor dem Ende der Feier.
Das Volk in passivem Widerstand, die Truppen der Koalition im Vormarsch auf Frankreich – ihm bleibt nur eins: ein schneller militärischer Erfolg. Am 12. Juni verlässt er um drei Uhr morgens die Tuilerien und bricht zur Armée du Nord auf, die an der Grenze zum Vereinigten Königreich der Niederlande steht. Die Entscheidung naht.
Seine Umgebung bewundert die Disziplin und gedankliche Klarheit des Herrschers. Selbst kleinste Details erinnert er. Unermüdlich diktiert er Briefe, treibt seine Minister an.
Am liebsten, so hat es den Anschein, würde er alles selbst erledigen.
Doch der Kraftakt zehrt. Der Kaiser ist körperlich sichtlich geschwächt. Der Selbstmordversuch nach seiner Abdankung vor einem Jahr in Fontainebleau hat Spuren hinterlassen. Seither braucht er ein Taschentuch, um sich den Speichel wegzuwischen, der unkontrolliert aus dem Mundwinkel tropft. Sein Atem geht schwer und unregelmäßig. Beim Reden unterbricht ihn immer wieder Husten.
Auch äußerlich lässt er sich gehen. Aus seinem Hemd, das sich über seinen beachtlichen Bauch spannt, quillt Unterwäsche. Er wirkt verbraucht, vorzeitig gealtert – und nicht wie ein Mittvierziger auf der Höhe seiner Kraft, der bereit ist, es mit dem Rest Europas aufzunehmen.
Briten und Preußen sind Napoleon überlegen - wenn sie es schaffen, sich zu vereinen
Napoleon will das machen, was er immer getan hat, wenn seine Armee in Unterzahl war: präventiv losschlagen, nicht reagieren. Den Gegner überrumpeln und mit geballten Attacken auf dessen zentrale Position in die Knie zwingen.
Er weiß, dass er nur dann eine Siegeschance hat, wenn er verhindern kann, dass sich die Armeen Blüchers und Wellingtons vereinigen. Die Preußen stehen zwischen Charleroi und Lüttich, Wellingtons Soldaten südwestlich von Brüssel. Die Armee der Österreicher wird erst Anfang Juli erwartet, das Heer der Russen noch später.
Der Preuße kommandiert 130.000 Mann, der Brite gut 90.000; Napoleon selbst stehen knapp 123.000 Soldaten zur Verfügung. Einzeln kann er seine Gegner besiegen; wenn sie sich vereinigen, wird er ihnen unterliegen.
Er will einen Keil schlagen zwischen die beiden Armeen, Charleroi jenseits der Grenze besetzen und dann weiter auf Brüssel vorstoßen. So könnte er Wellingtons Heer zum Ärmelkanal drängen und Blüchers Truppen über den Rhein zurücktreiben.
Als Erstes greift er die Preußen an. Und tatsächlich: Blüchers Soldaten vermögen der ersten Attacke der Franzosen am 16. Juni in der Nähe von Ligny nicht standzuhalten. Bei strömendem Regen ergreifen die Preußen schließlich die Flucht; mehr als 18.000 preußische und fast 14.000 französische Soldaten sind verwundet oder tot.
Aber Napoleon ist nicht mehr der Alte. Er lässt sich Zeit für seine Gefechtspläne, zögert mit Entscheidungen. Am Morgen kommt er erst spät aus dem Bett. Er macht Fehler, unterschätzt seine Gegner. Wellington hält er für unfähig, und nach der Schlacht von Ligny glaubt er die Preußen in heilloser Flucht und lässt sie ziehen. Erst verspätet ordnet er an, sie zu verfolgen.
Seinen Marschall Ney hat er bereits vor der Schlacht beauftragt, eine Wegkreuzung zu erobern, an der Engländer den Weg nach Brüssel blockieren. Das misslingt in verlustreichen Kämpfen. Als Wellington dort dennoch am 17. Juni einen taktischen Rückzug nach Norden anordnet, glaubt Napoleon abermals, dass seine Gegner ungeordnet fliehen.
Er verkennt, dass Wellington auf diese Weise Zeit gewinnen will, um sein Heer mit Blüchers Truppen zu vereinen.
Die haben sich inzwischen neu gesammelt und marschieren in Richtung der Briten. Napoleon wird diese Nachricht zugetragen, doch er spielt die Gefahr herunter. Er trifft keinerlei Vorkehrungen, seine rechte Flanke gegen einen möglichen Angriff der Preußen zu schützen. Offenbar hofft er, vorher Wellingtons Truppen mit überlegener Feuerkraft und seinen kampferprobten Gardisten schlagen zu können.
Bei dem Dorf Waterloo lässt Wellington seine Truppen halten und baut Verteidigungsposten auf. Napoleon glaubt die Gegner in der Falle. „Nun habe ich sie“, sagt er am Vorabend der entscheidenden Schlacht.
Die Schlacht von Waterloo wird Napoleons letzte Schlacht
Waterloo, 18. Juni 1815, ein grauer Tag. Hügel, Wiesen und Kornfelder sind regenschwer nach den Wolkenbrüchen der vergangenen Nacht. Napoleon sitzt mit seinen Kommandeuren beim Frühstück in einem Bauernhaus, in dem er sein Hauptquartier aufgeschlagen hat.
Er hat eine schlechte Nacht gehabt. Seine Hämorriden haben ihn geplagt. Die Stimmung ist gereizt. Er will angreifen und wischt alle Ratschläge seiner Offiziere, die zur Vorsicht mahnen, brüsk beiseite: „Ich sage Ihnen, Wellington ist ein schlechter General, und die Engländer sind schlechte Soldaten. Das Ganze wird nichts als ein Picknick sein.“
Doch ehe er losschlägt, will er das Gelände etwas trocknen lassen. Erst kurz vor zwölf Uhr gibt er den Angriffsbefehl. Schwere Kanonen eröffnen das Bombardement, dann greifen Napoleons Infanteristen an.
Gemäß ihren Anweisungen attackieren sie Wellingtons zentrale Stellung – und werden gnadenlos niedergeschossen. Das liegt auch daran, dass sie sich in zwei gewaltigen Kolonnen, 200 Mann in einer Reihe, wie Schießbudenfiguren zum Abschuss präsentieren. Unerklärlicherweise unternimmt Napoleon nichts, um diesen verheerenden taktischen Fehler seiner Generäle zu korrigieren.
Dann stürmen Marschall Neys Reiter vor. Aber die Truppen unter Führung Wellingtons halten den Kavallerie-Attacken der Franzosen unerwartet stand. Nichts geht nach Plan.
So hartnäckigen Widerstand hat Napoleon Wellington nicht zugetraut. Er befiehlt einen weiteren Angriff. Diesmal hat er mehr Erfolg: Die britischen Stellungen beginnen zu wanken. Es ist später Nachmittag. Da naht das preußische Heer von Osten und drängt die zahlenmäßig unterlegenen französischen Truppen zurück.
Doch trotz der nun drohenden gegnerischen Übermacht ordnet Napoleon keinen taktischen Rückzug an. Im Gegenteil: Abermals setzt er alles auf eine Karte. Er schickt die Kaiserliche Garde, die ihn nie im Stich gelassen hat, gegen Wellingtons Stellungen. Es ist sieben Uhr abends. Wieder stürmen die Franzosen. Auf 50 Meter kommen sie heran. Dann eröffnen die Briten das Feuer.
Der französische Vorstoß scheitert im Hagel der Musketenkugeln. Anstatt „Vive l’Empereur“ brüllen Napoleons Soldaten nur noch „Sauve qui peut“ – rette sich, wer kann – und fliehen. 25.000 Franzosen und 22.000 Krieger der Koalition bleiben verwundet oder getötet zurück. Es ist acht Uhr abends, und Napoleon ist geschlagen.
Noch immer allerdings fantasiert er davon, das Blatt wenden zu können. Eilt nach Paris zurück, um neue Truppen zu organisieren. 300.000 Mann, schreibt er seinem Bruder noch am Morgen nach der Schlacht, könne er aufstellen.
Doch nun ist Schluss. Beide Kammern des Parlaments verlangen endgültig und unwiderruflich seine Abdankung.
Napoleon wird auf die Insel St. Helena verbannt
Am 22. Juni, vier Tage nach der Niederlage in der Schlacht von Waterloo, muss Napoleon für immer auf den Thron verzichten. Der Flug des Adlers ist zu Ende, gut 100 Tage nach seinem Aufbruch von Elba.
In den Wochen darauf versucht sich der einstige Kaiser heimlich abzusetzen. Er flieht vor den anrückenden Koalitionstruppen auf die Insel Ile d’Aix an der Westküste. Mit einem der letzten verbliebenen französischen Kriegsschiffe will er nach Amerika entkommen. Jenseits des Atlantiks hofft er auf Asyl. Und wer weiß, was die Zukunft noch bringen mag.
Doch als das Schiff auslaufen soll, versperrt ihm die britische „Bellerophon“ die Ausfahrt. Napoleon ist in der Falle.
Am 15. Juli begibt er sich freiwillig an Bord des englischen Seglers. Er ist nun Gefangener der Briten. London erneuert bald darauf die Verbannung – allerdings an einen anderen Ort. Die Briten bringen den gefallenen Kaiser auf eine ihrer entlegensten Besitzungen: Am 15. Oktober landet er auf der Insel St. Helena im Südatlantik, 8000 Kilometer von Frankreich entfernt, mehr als 2400 Kilometer von der nächstgelegenen Küste in Afrika.

Tatsächlich haben die Briten ihren Gefangenen damit zur schlimmsten Strafe verurteilt, die man einem Tatmenschen wie Napoleon auferlegen kann: zur Tatenlosigkeit. Von St. Helena, einem zehn mal 15 Kilometer messenden Felsbrocken im Nichts des Meeres, kann es kein Entrinnen geben.
Napoleon wohnt in Longwood House, einem rattenverseuchten, feuchten, hölzernen Bauernhaus. Ein kleiner Hofstaat umgibt ihn: Drei seiner Offiziere hat er in die Verbannung mitnehmen können, seinen Leibarzt und zwölf Bedienstete. Inmitten von Lavafeldern legt er einen Blumengarten an und führt einen Kleinkrieg mit seinem britischen Aufseher, der den Gefangenen selbst in dessen Haus nicht aus den Augen lässt.
Rot uniformierte Soldaten stehen permanent Wache vor Longwood House. Ständig patrouillieren zwei britische Kriegsschiffe um St. Helena. Dabei gibt es lediglich fünf oder sechs Stellen an der schroffen Küste der Insel, wo auch nur ein Ruderboot anlanden könnte. Zu tun gibt es für Napoleon nichts, nichts mehr gibt es zu erringen – nur eines noch: seinen eigenen Nachruhm.
Napoleons wenige verbliebene Getreue werden später die „vier Evangelisten“ genannt werden: ein General, sein letzter Ordonanzoffizier in Waterloo und zwei seiner Kammerherren. Auf St. Helena begleiten sie den ehemaligen Herrscher fast ununterbrochen, zeichnen pedantisch seine Gespräche in ihren Tagebüchern auf. Und der ehemalige Kaiser weiß, dass seine Worte notiert werden. Immer wieder erklärt er in den Unterhaltungen das eigene Scheitern. Entwirft seine eigene Heilsgeschichte.
Nicht er hat versagt, Schuld tragen immer andere. Seine Gefangenschaft ohne Aussicht auf Erlösung stilisiert er zum Martyrium. „Der Sturz lässt Herrscher für gewöhnlich klein werden, mich hingegen hat er unendlich emporgetragen. Jeder Tag befreit mich von meinem Anstrich eines Tyrannen, eines Mörders, eines Wilden.“
Aus dem Despoten wird in den Aufzeichnungen seiner Begleiter (die nichts als seine Gedanken wiedergeben) ein selbstloser Heros. Napoleon macht sich zum Vorkämpfer dessen, was er als Herrscher immer missachtet hat: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – und des Selbstbestimmungsrechts der Völker.
Doch am Ende langweilt er sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode. Am 5. Mai 1821 stirbt – 51-jährig – jener Mann, der zwei Jahrzehnte lang Europa in Atem gehalten und sich zum Herrscher eines Reiches gemacht hatte, wie es der Kontinent seit den Zeiten der Römer nicht kannte. Der Millionen Menschen unterwarf und Hunderttausende auf den Schlachtfeldern opferte. Einer der mächtigsten Emporkömmlinge aller Zeiten, der als Feldherr, Politiker und Tyrann das Abendland prägte wie kaum ein anderer.
Vermutliche Todesursache: Magenkrebs. Vier Tage danach wird sein einbalsamierter Leichnam in einem Bleisarg, seinem Wunsch gemäß, im Grund einer Schlucht auf St. Helena bestattet.
Fast 20 Jahre später lässt Louis-Philippe, der Bürgerkönig von Volkes Gnaden, Napoleons sterbliche Überreste von St. Helena nach Paris überführen und am 15. Dezember 1840 feierlich im Invalidendom bestatten.
Da hat Napoleons Nachleben, der Mythos vom Herrscher, der Europa die Freiheit brachte, längst begonnen.