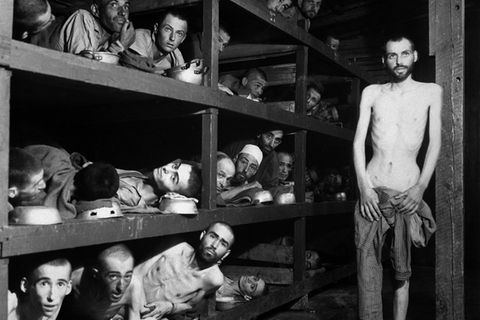GEO: Herr Kacorzyk, die Befreiung des KZ Auschwitz liegt nun 80 Jahre zurück. Das bedeutet auch, dass die letzten KZ-Überlebenden in absehbarer Zeit versterben. Wie kann das Gedenken an den Holocaust dennoch wachgehalten werden?
Andrzej Kacorzyk: Das ist eine Herausforderung, mit der wir uns schon seit mehreren Jahrzehnten beschäftigen. Wir sehen vor allem vier Strategien, das Gedenken wachzuhalten, erstens: Wir als Mitarbeitende der Auschwitz-Gedenkstätte müssen die Rolle der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen übernehmen, zumindest so gut es geht. Wir sind die Menschen, die für die Zeugen zeugen können, und zwar aus unserer direkten persönlichen Erfahrung mit dem Erbe der Überlebenden.
Aber es ist doch ein Unterschied, ob man als Gedenkstättenbesucher direkt mit einem KZ-Überlebenden sprechen kann oder mit einem Ihrer Mitarbeitenden?
Absolut. Wir können die Zeitzeugen nicht ersetzen. Dennoch arbeiten hier ungefähr 500 Personen, die alle eine ganz individuelle Beziehung zu Auschwitz haben. Wissen Sie, wenn Sie acht Stunden am Tag an diesem Ort arbeiten, an dem die abscheulichsten Verbrechen der Menschheit stattfanden, dann ist das kein normaler Job. Für viele ist es eine Mission. Nehmen wir einen Restaurator, der eine leere Dose Zyklon B vor sich hat, das Mittel, mit dem Häftlinge vergast wurden, und der sich damit beschäftigt, wie dieser Gegenstand für die nächste Generation bewahrt werden kann. Solch eine Arbeit löst Emotionen in uns aus. Wir Mitarbeitende können aus einer individuellen Perspektive über Auschwitz sprechen.
Wie lassen sich die Verbrechen von Auschwitz noch vermitteln, wenn die Zeitzeugen nicht mehr da sind?