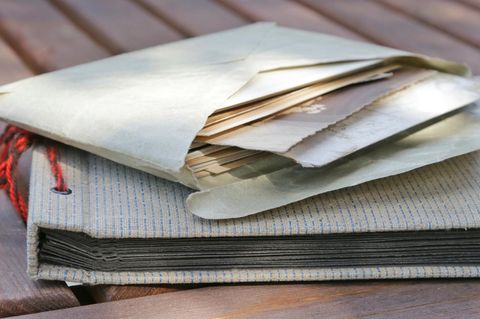Jeder und jede von uns verwaltet ein schier grenzenloses Archiv der Erinnerungen: Unser Gedächtnis steckt voller Erlebnisse, Sinneserfahrungen, voller Daten und Informationen, voller Begegnungen, Orte, Menschen. Unentwegt kommen neue Eindrücke hinzu. Manche Momente sind uns nur kurze Zeit noch präsent, verlieren sich im Vergessen. Andere Situationen speichern wir ein Leben lang. Doch welche Ereignisse gelangen in den neuronalen Speicher in unserem Kopf? Welche Hirnregionen spielen die Hauptrolle bei der Gedächtnisbildung? Wer diesen komplexen Prozess in Kürze verstehen will, sollte die Dramaturgie unseres Gedächtnisses kennen: den zeitlichen Verlauf vom Erkennen über die Emotionen bis zum Langzeitgedächtnis.
0,2 Sekunden: Alles beginnt mit dem Erkennen
Unentwegt prasselt eine Flut unterschiedlicher Eindrücke auf uns ein: Bilder, Geräusche, Gerüche, Berührungen. Doch welcher Eindruck findet schließlich seinen Weg in unser Gedächtnis? Die beste Chance, ins hirneigene Archiv zu gelangen, haben jene Reize, die unsere Aufmerksamkeit besonders erregen. Zum Beispiel der Anblick eines geliebten Menschen, der umwerfende Duft einer frischen Waffel, ein Kuss. Zunächst nehmen unsere Sinnesorgene, Nase, Ohren, Augen, die Haut, die entsprechenden Informationen aus der Außenwelt auf und schicken in weit weniger als einer Sekunde entsprechende Impulse in Richtung Hirn. Dort, in der Mitte des Denkorgans, sitzt der Thalamus – auch "das Tor zum Bewusstsein" genannt, da er entscheidet, ob wir einer Sache gewahr werden. Und worauf wir uns mit unserem wachen Ich fokussieren.
0,25 Sekunden: Emotionen – die Würze der Erinnerung

Besonders gut in unserem Gedächtnis verankern sich Ereignisse immer dann, wenn sie starke Emotionen auslösen. Positive oder negative. Ein freudiges Wiedersehen nach Jahren? Ein jäher Schmerz im Fuß? Oft sind es vielfältige emotionale Reize, und sie kursieren zwischen mehreren Hirnregionen, die zeitgleich aktiviert werden. Einen bedeutenden Part in diesem Kreislauf stellt die Amygdala dar. Das kleine Areal mitten in unserem Gehirn gehört zum limbischen System, das der Verarbeitung unserer Emotionen dient. In Sekundenbruchteilen reagiert die auch Mandelkern genannte Struktur und schickt Signale an andere Regionen unseres Oberstübchens weiter. So können wir im Zweifel auf eine Situation reagieren, noch bevor wir uns des Geschehens bewusst sind.
0,2 bis 0,5 Sekunden: Auf dem Weg zur bewussten Empfindung
Erst wenige Millisekunden, nachdem die Amygdala eine emotionale Reaktion angestoßen hat, werden wir uns auch der eigentlichen Empfindungen bewusst. Je sinnlicher und intensiver diese Impressionen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns auch später noch an das Geschehen erinnern. Am besten können wir uns in der Regel visuelle Eindrücke merken: Denn das, was unsere Augen aufnehmen und über die Sehnerven in den visuellen Kortex im Hinterkopf schicken, dem Verarbeitungsort für visuelle Reize, gelangt besonders leicht zum Hippocampus. Diese Hirnregion – ihrer Ähnlichkeit wegen nach dem altgriechischen Wort für Seepferdchen benannt – gilt als die Pforte zum Gedächtnis.
0,5 Sekunden: Nun aber ab ins Kurzzeitgedächtnis!
In der ersten halben Sekunde entscheidet unser Hirn, ob ein Ereignis, ein Reiz, ein neuer Eindruck zur ersten Station im Prozess des Speichers und damit ins Archiv unseres Kopfes gelangt: dem Kurzzeitgedächtnis, das vor allem im Präfrontalkortex hinter unserer Stirn sitzt und Daten für Sekunden oder Minuten festhält. Bei diesem Vorgang zirkulieren die Informationen in Form unzähliger elektrischer Nervenimpulse zwischen jenem Hirnareal, in dem die Sinnesreize verarbeitet werden (etwa dem visuellen Kortex im Hinterkopf), und dem Präfrontalkortex hinter unserer Stirn, der den bewussten Fokus auf die Signale legt. Es dauert nun einige Zeit, bis sich das Gehirn entscheidet, was mit den Informationen weiter geschehen soll. Sollen sie verworfen, gelöscht, für immer vergessen werden? Oder sind sie es wert, in die Bibliothek des Langzeitgedächtnisses aufgenommen und einsortiert zu werden?

Zehn Minuten bis zwei Jahre: Wenn Erinnerungen gefestigt werden
Nicht alles, was wir erleben, landet gleich schnell in unserem Langzeitgedächtnis. So brauchen wir meist einige Zeit, um Fachwissen derart fest im Archiv zu verankern, dass wir uns ein Leben lang an die Fakten und Zusammenhänge erinnern. Die Signale müssen in der Regel einige Male durch die entsprechenden Hirnwindungen geschickt werden, damit wir die Informationen dauerhaft zu memorieren vermögen. Dagegen können wir uns eindrückliche Situationen – ein Urlaubsabenteuer etwa, eine spannende Begegnung – oft noch Jahre später ins Gedächtnis rufen, obwohl wir sie bloß einmal erlebt haben. Bei der Entscheidung, welche aller unserer Erinnerungsfetzen im Langzeitgedächtnis gespeichert werden, spielt der Hippocampus eine entscheidende Rolle. Er wählt gewissermaßen aus, welcher Eindruck aus unserem Leben weiterschreiten darf im komplexen Prozess der neuronalen Archivierung. Das Langzeitgedächtnis selbst hat keinen eng umrissenen Ort, seine vielschichtigen Inhalte werden in unterschiedlichen Bereichen der gesamten Großhirnrinde hinterlegt.
Mehr als zwei Jahre: Jedes Mal eine andere Geschichte
Mitunter vergehen auch Jahre, bis Informationen langfristig in unserem Gedächtnis implementiert sind. Bei diesem Vorgang werden die entsprechenden Neuronen im Hippocampus und der Hirnrinde, die für die Speicherung eines spezifischen Inhalts zuständig sind, wieder und wieder synchron aktiviert. Dies geschieht auf denselben neuronalen Pfaden, und so verfestigen sich die Erinnerungen mehr und mehr in den jeweiligen Hirnstrukturen. Bei diesem Prozess kommt es allerdings regelmäßig vor, dass wir die Erinnerungen verfälschen, denn mit jedem bewussten Wachrufen verknüpfen wir die betreffenden Inhalte auch mit Emotionen, die mit der Situation ebendieses neuerlichen Erinnerns verknüpft sind. Nicht selten erfinden wir auch – ohne dass uns dies bewusst ist – Neues hinzu oder tilgen Aspekte aus dem Archiv. So ist unser Gedächtnis ein hochdynamisches Konstrukt. Die einzelnen Erinnerungen sind keineswegs statisch, sondern gleichen vielmehr Geschichten, die sich mit jedem Erzählen ein Stückweit wandeln.